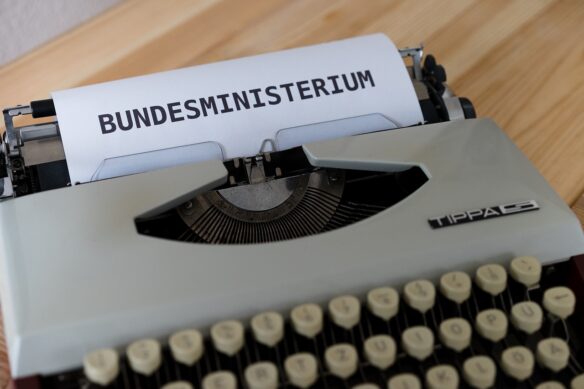
Wie agile Arbeitsformen in Ministerien eingeführt werden
Es gibt gute Gründe, Ministerinnen und Ministern hohe Autonomie in Bezug auf ihre Ressorts einzuräumen. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die nötigen Fachexpertisen in einem Thema, um Gesetze umzusetzen oder Fördervorhaben aufzusetzen. Die Verantwortung kann bei den jeweiligen Ministerinnen und Ministern verortet werden, weil sie nicht von einem Präsidialamt oder einem Kanzleramt vorgegeben, sondern von den Ministerien selbst vorangetrieben werden.
Effekt ist dabei nicht nur eine hohe Autonomie bei der Gestaltung der Politik des einzelnen Fachressorts, sondern auch bei der Organisation des eigenen Ressorts. Jedes Ministerium kann über ihre Zentralabteilungen selbst definieren, wie ihre Akten aussehen sollen, wie an Gesetzesvorlagen gearbeitet wird, wie Personaleinstellungen dokumentiert werden, Personalbeurteilungen vorgenommen werden und Rechnungen beglichen werden sollen. Jedes Ministerium verfügt über eigene Stellen und Budgets, mit denen diese Verfahren an die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Ministeriums angepasst werden können.
Die zunehmenden Möglichkeiten der Digitalisierung zeigen aber immer stärker die Nachteile der Autonomie von Ministerien bei der Gestaltung ihrer Verwaltungsabläufe auf. Die elektronischen Akten sind zwischen den Ministerien nicht kompatibel und müssen mühsam konvertiert werden. Die ressortübergreifende Zusammenarbeit an Gesetzesvorlagen wird erschwert, weil jedes Ministerium eigene Verfahren des gemeinsamen Arbeitens an einem Dokument nutzt. Der Wechsel des Personals zwischen Ministerien wird erschwert, weil Personalakten nicht digital zwischen den Häusern ausgetauscht werden.
Es werden deswegen Koordinationsgremien aufgesetzt, die sich auf der Ebene der Staatssekretäre, auf der Ebene der Leitungen der Zentralabteilungen und auf der Arbeitsebene der Referatsleitungen um eine Standardisierung zwischen den Ministerien bemühen. Die Effekte sind aber begrenzt, weil die Zentralabteilungen der einzelnen Ministerien die Autonomie bei der Gestaltung ihrer Verfahren und die Verfügbarkeit über ein eigenes Budget nicht aufgeben wollen. In den Koordinationsgremien werden deswegen Vereinbarungen getroffen, die regelmäßig in der konkreten Umsetzbarkeit versanden. Faktisch wagt sich niemand an die Ressorthoheit bei den Verwaltungsverfahren heran, weil man damit in der Öffentlichkeit politisch keinen Blumentopf gewinnen kann, gleichzeitig aber die Chance, am Widerstand aus den einzelnen Ministerien zu scheitern, erheblich ist.
Dies führt nicht zuletzt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den einzelnen Ministerien agilere Arbeitsformen durchsetzen sollen, zu Frustrationen. Zwar trifft man sich ressortübergreifend mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ministerien, an die relevanten Themen – Etablierung gemeinsamer ressortübergreifender technischer Standards, Nutzung gemeinsamer Server durch die Ministerien oder Aufweichung der seit Jahrzehnten etablierten Aufteilung der Ministerien in Referaten – kommen sie nicht heran.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ziehen sich darauf zurück, den Einsatz agiler Tools in den Ministerien zu propagieren. Es werden Workshops zum Design Thinking durchgeführt, einzelne Referate in ihrer Arbeit durch Retrospektiven unterstützt, Canvas wird als Tool in Abteilungen eingeführt und Projektgruppen in der Durchführung von Sprints geschult. Die Hoffnung ist, dass es durch diese Maßnahmen „bottom up“ gelingen kann, das Arbeiten in den Ministerien zu verändern. Aber faktisch handelt es sich um symbolische Aktionen, die es den Ministerien ermöglichen, sich einen agilen Anstrich zu geben, ohne dass sich an den Arbeitsformen grundlegend etwas ändert. Ein agiler „Toolismus“ kaschiert so die Unfähigkeit, die strukturellen Blockaden in der Ministerialverwaltung aufzuheben.
Aus „Managementmoden nutzen. Eine sehr kurze Einführung“ (Springer VS 14,90). Die Publikation der Auszüge soll die Auseinandersetzung mit den Überlegungen zu Managementmoden ermöglichen.

Schreibe einen Kommentar