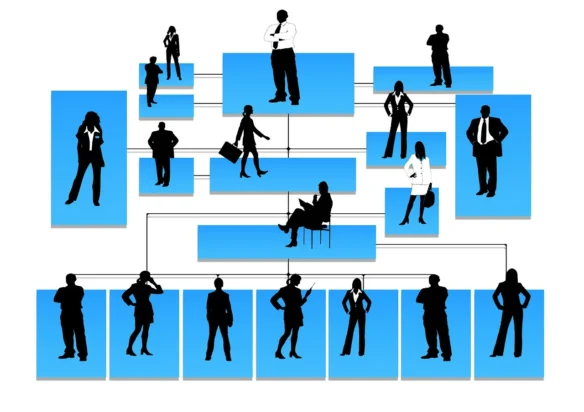
Kaum ein Thema ist in der Managementliteratur so intensiv und umfassend behandelt worden wie das der selbstorganisierten Teams. Die Funktionsweise von selbstorganisierten Teams ist inzwischen nicht nur für die Schlüsselindustrien der Automobil-, Maschinenbau-, Elektronik- und Chemiebranche beschrieben worden, sondern auch für Unternehmen aus der Softwareentwicklung und dem Dienstleistungsbereich, für Organisationen der öffentlichen Verwaltung, für Serviceleister in der Pflege und für Krankenhäuser. Die Managementliteratur ist voll von Aneinanderreihungen von Erfolgsgeschichten von Unternehmen, die selbstorganisierte Teams eingeführt haben.
Ein bekannter mittelständischer Zulieferer der Automobilindustrie – nennen wir ihn hier Ladra – führt unter dem Label der teilautonomen Gruppenarbeit sich selbstorganisierende Teams ein. Die Selbstbeschreibung des an der Einführung beteiligten Managements sowie die Berichte der Begleitforscher, lesen sich als wirtschaftliche Erfolgsgeschichten. Bei Ladra werden die Effekte der Gruppenarbeit mit Stichworten wie „höhere Wirtschaftlichkeit, geringere Gemeinkosten“, „signifikante Ersparnis bei Gemeinkosten“, „deutliche Qualitätsverbesserung und Kosteneinsparung“ und „Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit durch kostengünstigere Organisation“ beschrieben. Es wurde festgestellt, dass sich der Umsatz pro Arbeitsstunde in sechs Jahren um 50 Prozent gesteigert hat. Deswegen wird dieses Unternehmen in der Managementliteratur als eine Vorzeigeorganisation für selbstorganisierte Teamarbeit gefeiert.
Die hohe Aufmerksamkeit, die dem Unternehmen in der Managementliteratur zuteilwurde, bedeutete für das Management deutlich verbesserte Karrierechancen. Der Personalleiter von Ladra wechselte als einer der Vorreiter für die Einführung von selbstorganisierten Teams in eine andere Firma. Der Personalleiter des Gesamtkonzerns, der die Einführung der neuen Unternehmensformen begleitete, machte sich mit dem Thema Selbstorganisation als Unternehmensberater selbstständig und akquirierte seine ersten Aufträge mit dem Verweis auf den Erfolg seiner früheren Firma.
Hätte man jedoch auf die Hinterbühne des Unternehmens geschaut, wäre jedem Beobachter schnell deutlich geworden, dass die selbstorganisierten Teams nach der Einführung nur noch auf der Schauseite existierten. Die eingeführten kunden- bzw. produktbezogenen Fertigungsinseln wurden schnell wieder aufgelöst und die klassischen verfahrensorientierten Abteilungen wiedereingeführt. Die indirekten Aufgaben wie Personalplanung, Auftragsfeinsteuerung, Wartung und Qualitätssicherung, die ursprünglich in die Kompetenz der Inseln übertragen worden waren, wurden wieder in Zentralbereichen zusammengefasst. Den Gruppensprechern wurden wieder hierarchische Weisungsbefugnisse zugesprochen. Sie wurden, wie es der Geschäftsführer ausdrückt, „wieder ein bisschen“ zu Abteilungsleitern oder Schichtleitern. Das ganze Unternehmen, so der Geschäftsführer in einem vertraulichen Gespräch, befinde sich auf einem Weg „zurück in die Zukunft“.
Aber es wäre vorschnell, diese Gruppenarbeitsprojekte als gescheitert zu bezeichnen, nur weil die selbstorganisierten Teams lediglich auf der Schauseite existieren. Allein die Präsentation als Vorreiterunternehmen für Gruppenarbeit hatte positive Effekte. Erstens gelang es der Geschäftsführung, sich durch das Gruppenarbeitsprojekt wichtigen Spielraum zu verschaffen. Mit der Ankopplung an die aktuellen dezentralen Produktionskonzepte gelang es den Geschäftsführern, die Holdings davon zu überzeugen, nochmals erhebliche Investitionen in die defizitären Unternehmen zu stecken. Zweitens zeigte sich, dass die Einführung der Gruppenarbeit ein zusätzliches Verkaufsargument darstellte und zu einer Verbesserung der Absatzchancen im Kernmarkt Automobilindustrie führte.
Aus „Managementmoden nutzen. Eine sehr kurze Einführung“ (Springer VS 14,90). Die Publikation der Auszüge soll die Auseinandersetzung mit den Überlegungen zu Managementmoden ermöglichen.

Schreibe einen Kommentar