Schlank, kooperativ oder handlungsfähig soll der Staat endlich wieder sein: Die Kritik an der Bürokratie ist so alt wie die Bürokratie selbst. Sie hat verheerende Effekte
Die Beschwerde über zu viel Bürokratie ist zu einem post-modernen Äquivalent der Klage über schlechtes Wetter geworden.[1] Die Kritik hat sich dabei kaum verändert. Die „Bürokratie“, so die regelmäßig vorgebrachte Klage, würde sich wie Mehltau über das Land legen. Eine unsinnige Regelungsflut, eine verknöcherte Verwaltung und ein wuchernder Beamtenapparat würden inzwischen jede Initiative unterdrücken. Angesichts der routinierten Wiederholung der immergleichen Bürokratiekritik fühlen sich Beobachter schon an den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ erinnert, in dem der in einer Zeitschleife gefangene Protagonist sich jeden Morgen den immer gleichen Text anhören muss.[2]
Fast genauso alt wie die Klage über die Bürokratie sind die Versuche, der überbordenden Bürokratie Einhalt zu gebieten.[3] Seit einem Jahrhundert gehört die Forderung nach einem Bürokratie-Moratorium, einer Eingrenzung der Regulierungsflut und einem Einstellungsstopp für den öffentlichen Dienst zum Standardrepertoire vieler Politikerreden. In immer kürzeren Zeitabschnitten werden dabei Kommissionen zum „Bürokratieabbau“, zur „Entbürokratisierung“ und zur „Deregulierung“ eingerichtet, die sich häufig nur noch dadurch unterscheiden, dass das Wort „Staat“ mit immer neuen Adjektiven – „schlank“, „aktivierend“, „kooperativ“ oder neuerdings „handlungsfähig“ – variiert wird.
Kaum eine Expertengruppe ist dabei so erfolgreich gewesen wie die Initiative des ehemaligen Verfassungsrichters Andreas Voßkuhle, dem ehemaligen Verteidigungs- und Innenministers Thomas de Mazière, dem ehemaligen Finanzminister Peer Steinbrück und der ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Gruner + Jahr Julia Jäkel. Von pauschalen Forderung nach „guter Gesetzgebung“ über die Einrichtung von „Experimentierklauseln“ bis hin zur „Neuordnung der föderalen Beziehungen“ – ein großer Teil der Ideen der Kommission sind in den Koalitionsvertrag eingeflossen.[4] Angesichts der teilweise wortgleichen Formulierungen stellt sich zwangsläufig die Frage, ob man auch in einem Koalitionsvertrag plagiieren kann.
Der Staatsrechtler Florian Meinel vermutet hinter dem Papier der vier „Ehemaligen“ einen neuen „Populismus der Eliten“. Hinter dem Begriff der „Staatsreform“ versteckten sich seiner Meinung nach in Wirklichkeit eine Mischung aus einem „konservativen Krisendiskurs“, der „alten konservativen Kritik des Wohlfahrtstaates“ und der Idee eines letztlich europafeindlichen „ökonomischen Nationalismus“.[5] Die Rechtswissenschaftlerin Angelika Nußberger geht Meinels Kritik viel zu weit. Sie sieht in der „Aufnahme von Millionen Geflüchteter“, der „erfolgreichen Bewältigung der Pandemie“ und der „rasante Umstellung auf eine Energieversorgung ohne russischen Gases“ kein Ausdruck der Handlungsfähigkeit des Staates, sondern betrachtet die Überlegungen der Kommission zu den „Gelingensbedingungen staatlichen Handelns“ als einen zentralen Hebel, um den „Vertrauensverlust“ der Bürger gegenüber dem Staat zu stoppen.[6]
Bei allem Widerspruch bezüglich der ideologischen Zielrichtung der Kommission überschätzen dabei beide Staatsrechtler die Rationalität solcher Kommissionsempfehlungen. Weil es außer dem durch Wahlen und Regierungsbildungen vorgegebenen Zeitdruck in den Kommissionen keinerlei Beschränkungen gibt, fließt alles Mögliche an Ideen in den Handlungskatalog ein. Jede Expertin und jeder Experte in der Kommission oder in den zuarbeitenden Arbeitsgruppen versucht dabei, eine Duftnote zu setzen, ohne dass besonders auf eine Konsistenz der Vorschläge geachtet werden muss. Am Ende steht ein „Kessel Buntes“, in dem sich eine wilde Mischung aus Lieblingsideen und Spezialinteressen der Experten wiederfinden. Ergebnis ist dann eine wilde Liste, die im Kommissionsbericht und darauf aufbauend im Koalitionsvertrag mühsam durch die begriffliche Klammer einer „echten Staatsreform“ zusammengehalten wird.
Dabei herrscht in der Politik und bei den ihnen zuarbeitenden Experten ein fast schon ermüdender Überbietungswettbewerb. Wenn eine Politikerin fordert, dass für ein neues Gesetz ein altes eingestampft werden muss, dann kann man sicher sein, dass kurz danach ein anderer Politiker fordert, dass für ein neues Gesetz mindestens zwei oder besser noch drei alte abgeschafft werden müssen. Wenn eine Regierung eine Reduzierung der Bürokratiekosten für die Wirtschaft um 10 Prozent fordert, dann verspricht die nächste Regierung garantiert durch ein „Bürokratierückbaugesetz“ ein „25-Prozent-Abbauziel“ zu erreichen.
Bei aller Widersprüchlichkeit im Detail laufen die Maßnahmen der Kommission und der Koalition auf ein umfassendes Bürokratiewachstumsprogramm zum Bürokratierückbau hinaus.[7] Als Lösung für die Bürokratieprobleme gibt man sich nicht mehr mit einer von der Regierungszentrale eingesetzten „Entbürokratisierungs-Beauftragten“, einer bei einem Ministerium angesiedelte „Geschäftsstelle Bürokratieabbau“ oder einem „starken Normenkontrollrat“ zufrieden, sondern richtet gleich ein Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung ein, dass als eine Art „Bürokratie-TÜV“ ein weiteres Wuchern der Bürokratie verhindern, das Regulierungsgestrüpp durchforsten und unnötige Regeln entfernen soll. Kurz – die Lösung für zu viel Bürokratie wird in einer konsequenten Bürokratisierung der Entbürokratisierung gesehen.
Auffällig ist, dass dabei einerseits die Forderungen nach einer Entbürokratisierung immer weitreichender werden und gleichzeitig die staatlichen Bürokratien immer mehr zuwuchern. Es ist nicht unüblich, so der Verwaltungswissenschaftler Werner Jann, dass Politiker einerseits eine ideologische Verteufelungskampagne gegen die Bürokratie betreiben, es aber parallel zu einem Wachstum der staatlichen Bürokratie kommt.[8] Die immer schärfer werdende Kritik der Bürokratie erfüllt, so die Rechtswissenschaftlerin Pascale Cancik, für die Politiker die Funktion der Selbstimmunisierung. Man bedient sich einer lediglich mit einigen bekannten Beispielen gespickten Bürokratiekritik, zeigt so seine Bereitschaft zur Selbstbegrenzung und präsentiert sich so als Treiber eines Bürokratieabbaus, kann aber gleichzeitig seine eigene Regulierungspolitik weiter vorantreiben.[9] Wenn man nur laut genug über die Bürokraten schimpft, wird nicht so leicht bemerkt, wenn man mal wieder ein Gesetz erlässt, das zu weiteren bürokratischen Belastungen der Bürger führt.[10]
Aber diese permanente Bürokratiekritik untergräbt, darauf hat zuletzt im Merkur der Rechtshistoriker Michel Küppers hingewiesen, langfristig die Akzeptanz des Staates. Alle richten sich in der „irrigen Vorstellung“ einer allgewärtigen, alles lähmenden Bürokratie ein. Nach dem Motto: „Die Bürokratie ist schlecht, die Bürokraten, das sind die anderen. Wenn etwas nicht funktioniert, dann ist die Bürokratie daran schuld.“ Die Effekte sind verheerend. Wenn Wählern über Jahrzehnte ein Bürokratieabbau versprochen wird, der faktisch gar nicht eingehalten werden kann, erodiert das Vertrauen in staatliche Instanzen.[11] Wenn Politiker ihrer jubelnden Anhängerschaft zurufen, dass mit der „überbordenden Bürokratie“ Schluss gemacht werden muss, wenn sie ihre Reden mit den immer gleichen Beispielen – die Vorschrift für den Krümmungsgrad von Gurken, die Hygienevorschriften, die von Schlachthöfen glatte Fliesen verlangen, während die Arbeitsschutzrichtlinien aufgeraute Bedingungen vorschreiben oder die Verpflichtung von Küstenländern, ohne größere Erhebungen eigene Seilbahngesetze zu erlassen – illustrieren, ist Staatsverdruss das Ergebnis.[12]
Das Problem ist nicht das Ringen um stringentere Gesetze, bessere Rechtsetzung oder intelligentere Verwaltungsstrukturen, sondern die in der Regel durch partikulare Interessen geleitete, aber dann mit dem Impetus einer Gemeinwohlorientierung vorgetragene Form der Bürokratiekritik. Wenn sich Parteipolitiker, Verwaltungsreformer und Interessenorganisationen darauf einigen würden, für eine Zeit lang auf eine allzu pauschale Bürokratiekritik zu verzichten, würde dies die Erosion des Vertrauens in staatliche Organisationen erfolgreicher stoppen, als wenn immer neue Kommissionen, neue Stellen und neue Programme zum Bürokratieabbau geschaffen werden.
Stefan Kühl ist Professor für Soziologie an der Universität Bielefeld. Zum Thema erschien zuletzt von ihm „Brauchbare Illegalität. Vom Nutzen des Regelbruchs in Organisationen“ (Campus Verlag).
[1] So Werner Jann, Kai Wegrich, Jan Tiessen: „Bürokratisierung“ und Bürokratieabbau im internationalen Vergleich – wo steht Deutschland? Berlin 2007, S. 11. Sie verweisen auf Clive Jones: Regulatory Creep. Myths and Misunderstandings. In: Risk & Regulation 8 (2004), S. 6, hier S. 6. „Complaining about regulation has become the
business equivalent of complaining about the weather.”
[2] So in einem prägnanten Essay Werner Jann: Bürokratieabbau: Und ewig grüßt das Murmeltier. Für mehr Ehrlichkeit in der Bürokratiedebatte. In: Zeitschrift für Rechtspolitik (2023), 56, S. 247–251, hier S. 247.
[3] Eine der ersten Maßnahmen der neu gebildeten Regierung in der Weimarer Republik war eine Kommission einzustellen, mit deren Hilfe Verwaltungsprozesse verschlankt und damit Kosten eingespart werden sollten. Die Nationalsozialisten propagierten die Auflockerung der Rechtsbindung von Verwaltungsentscheidungen auch als eine Maßnahme zur Beschleunigung von Entscheidungen. Schon bevor in der Nachkriegszeit mit der Gründung der Bundesrepublik eine neue Regierung gebildet worden ist, versuchten sich die Besatzungsbehörden an einer Verschlankung des Staates.
[4] Siehe dazu Julia Jäkel, Thomas de Maizière, Peer Steinbrück, Andreas Voßkuhle: Initiative für einen handlungsfähigen Staat. Zwischenbericht. Berlin 2025.
[5] Florian Meinel: So sieht der Populismus der Eliten aus. Topleute von gestern wollen nicht irren: Das Projekt einer „Staatsreform“ hat es in den Koalitionsvertrag geschafft. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung (12.4.2025), S. 12.
[6] Angelika Nußberger: Auch Topleute dürfen lernen. Vertrauensschäden machen klüger: Die Autoren der „Ideen für einen handlungsfähigen Staat“ haben Florian Meinels Spott nicht verdient. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung (15.4.2025), S. 11.
[7] Siehe für die EU dazu auch Andre Wilkens: Der diskrete Charme der Bürokratie. Gute Nachrichten aus Europa. Frankfurt a.M. 2017, S. 30.
[8] So die Beispiele aus der Woche der Einsetzung des Normenkontrollrates in der Bundesrepublik Deutschland bei W. Jann, K. Wegrich, J. Tiessen: „Bürokratisierung“ und Bürokratieabbau im internationalen Vergleich – wo steht Deutschland? (wie Anm. 1), S. 42.
[9] Siehe Pascale Cancik: Zuviel Staat? – Die Institutionalisierung der „Bürokratie“-Kritik im 20. Jahrhundert. In: Der Staat 56 (2017), S. 1–38..
[10] Ich rephrasiere hier Wolfgang Janisch: Bürokratieabbau – Warum dauert das so lange? In: Süddeutsche Zeitung (23.10.2023). Beim ihm heißt es „Wenn man nur oft genug über Bürokratieabbau redet, fällt es nicht so auf, wenn man wieder ein paar komplizierte Vorschriften erlässt.“
[11] Michel Küppers: Mehr Bürokratie wagen. In: Merkur 79 (2025), 4, 83-92, 92. Dort auch das Wort des Staatsverdrusses.
[12] Es würde sich lohnen, die Herkunft und den Erfolg dieser Anekdoten einmal näher zu untersuchen. Siehe zu den widersprüchlichen Anforderungen an die Fliesen von Schlachthöfen Ortlieb Fliedner: Gute Gesetzgebung. Welche Möglichkeiten gibt es, bessere Gesetze zu machen? Bonn 2001, S. 26. Zum Seilbahngesetz in Mecklenburg-Vorpommern siehe Nicolai Dose: Weshalb Bürokratieabbau auf Dauer erfolglos ist, und was man trotzdem tun kann. In: dms – der moderne staat – Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management (2008), S. 99–120, hier S. 101. „Auf einer Länge von zehn Zentimetern darf die Gurke nicht stärker als einen Zentimeter gekrümmt sein, um zur höchsten Güteklasse zu gehören.“. Die vorgeschriebene Gurkenkrümmung wird schon prominent bei Hans Magnus Enzensberger behandelt. Siehe Hans Magnus Enzensberger: Sanftes Monster Brüssel oder die Entmündigung Europas 2011. Ansätze für eine Archäologie der klassischen Beispiele der Bürokratiekritik finden sich am Beispiel der Gurkenkrümmung bei Pascale Cancik: »Bürokratie« als negative Markierung: Zur Semantik von Staats- und EU-Kritik. In: Leviathan 48 (2020), S. 612–636, 626ff.

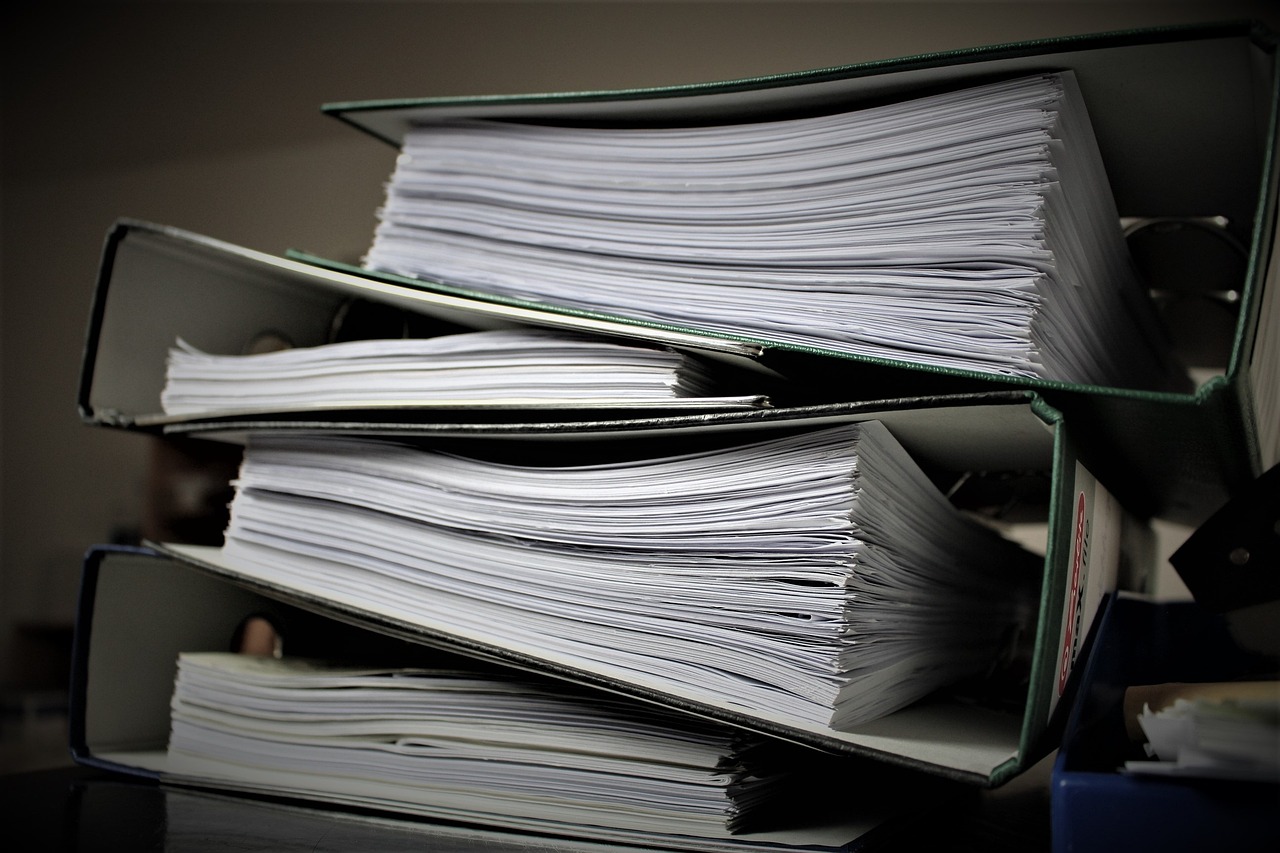
Schreibe einen Kommentar