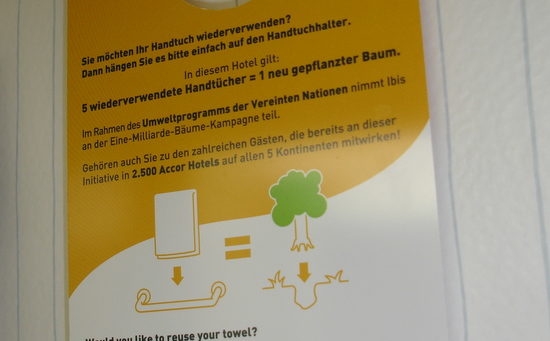
Denis Hennequin kennt sich aus mit günstiger Massenware. Bis Januar 2011 war Accor in Familienhand, seitdem führt der ehemalige Europachef von Mc. Donalds die Firma, die sich als globaler Gastwirtschaftsdienstleister versteht und in Deutschland vor allem durch ihre Mercure- und Ibis-Hotels bekannt ist. Die Mercure-Hotels entziehen sich dabei dem Spontanmanagement aus der Pariser Konzernzentrale. Bei den Ibis-Hotels kann sich Hennequin jedoch austoben. Die Architektur nimmt keine Rücksicht auf Stadtbilder, der Service ignoriert kulturelle und regionale Eigenheiten – es gibt nur eine Handlungsrationalität: Kosten senken, für den Kunden und den Betreiber.
Bei Mc. Donalds galt wahrscheinlich eine geheime Regel: 3 Gramm Ketchup pro Hamburger sind dem Kunden egal, dem Aktionär aber nicht. Eine ähnliche Maxime gilt nun auch für Ibis und – Hurra!, dachte man sich in Hennequins Büro – man muss sie nicht verstecken, sondern kann sie plakatieren: Wie oft wir dein Handtuch waschen, lieber Gast, ist dir doch eigentlich egal, der Umwelt aber nicht. Der Umwelt und dem Ibis-Haushalt natürlich.
Diese Episode aus dem Büro von Denis Hennequin kann ich doppelt, mit meinem Mitmenschen-Gewissen und meinem soziologischen Verständnis vereinbaren. Erlebt habe ich sie nicht. Wahr könnte sie (durch Zufall) sein. Sie ist aber plausibel. Und der Trick, eine plausible Beschreibung in eine erzählbare Story zu packen ist nicht zwingend unlauter, nur weil echte Personen in ihr vorkommen. Dennoch gibt es Regeln, die mir verbieten, diese Story ohne Weiteres zu erzählen. Die Soziologie soll mal außen vor bleiben, es ist klar, dass Storytelling für wissenschaftliche Texte falsch ist und im Vortrag gerade so zur Illustration genehm wäre, wenn sie ausdrücklich als Story (und nicht History) markiert ist.
Journalistisch ist die Sachlage aber unklar. Wie so überraschend vieles im Journalismus unklar ist. In der wissenschaftlichen Reflexion, in den Journalismus-Handbüchern und in der erlebten Praxis gibt es nur einen Aspekt, um den nicht gestritten wird: Der Journalismus kümmert sich um Neues. Zuerst kommt das Neue, dann wird eventuell das Bekannte kurz erwähnt, um den Neuheitsgrad des Neuen noch einmal herauszustellen. So funktioniert es überall. Im Radio, in den Zeitungen & Zeitschriften und im Fernsehen. Nachrichten sind neu. Es werden Bücher besprochen, die neu sind. Ausstellungen beschrieben, die aktuell sind. Alles, was im Journalismus stattfindet, benötigt einen aktuellen Anlass oder „Aufhänger“ und dieser muss den Neuigkeitsanforderungen genügen.
Nach dem WAS, bleibt aber die Frage des WIE. In der beobachtbaren Praxis schält sich eine interessante Spannungslage zwischen zwei Polen heraus. Soll das Neue wahrheitsgetreu oder gefällig aufbereitet werden. Beide Pole sind kombinierbar, sie stehen sich aber grundsätzlich unvereinbar gegenüber. In den großen Tageszeitungen folgt täglich das Feuilleton auf das Wirtschaftsbuch. Es werden also (idealtypisch) zuerst wissenschaftliche Wahrheiten in Form langer Texte auf journalistisches Textmaß reduziert und dann ein paar Seiten weiter werden (im weiteren Sinne) Kunstwerke, die von sich aus erstmal recht wenig Inhaltliches bedeuten, weil sie durch Ästhetik überzeugen, auf journalistisches Textmaß ‚aufgebläht‘. Durch das Handwerk des Journalismus erfährt „die Wirklichkeit“ eine tief greifende Transformation, bis sie in standardisierten Textzeilen präsentiert wird.
Der Journalismus ist in einem bestimmten, vergleichbaren Sinn ein Handwerk. Er operiert am (menschlichen) Klienten, wie es nur wenige andere Berufe etwa Anwälte, Lehrer/Professoren, Ärzte und personenbezogene Berater tun. Und es gibt einen zweiten Punkt, in dem sich diese Berufe ähneln: Man hat einen standardisierten Diagnose- und Handlungskatalog zur Hand (Rechtstext, Diagnose- & Therapieverfahren, Lehrplänen / Didaktik), muss aber in einer unzähmbaren Wirklichkeit an jeweils individuellen Einzelfällen operieren. Und so betrifft es auch den Journalismus. Eine unfassbare Wirklichkeit wird in ein vorgegebenes Medienformat gezwängt. Mit der oben beschriebenen zusätzlichen Schwierigkeit. Es gibt keine Prozessordnung (wie in der Juristik), keine Leitlinien (wie in der Medizin), keine durch Leistungskontrollen sensibilisierten Lehrpläne (wie in der Schule). Es bleibt allein der Wunsch, ein Publikum wahrheitsgetreu zu informieren, obwohl man nicht weiß, ob es nicht lieber bloß unterhalten werden will.
(Entsprechend skurril muten deswegen manche selbstbezogenen Meldungen an. Die Neue Westfälische in Bielefeld hat beispielsweise diesen April eine neue Druckermaschine in Betrieb genommen, die die Tageszeitung der Region durchgehend bunt druckt. Doch anstatt zu sagen, dass die Zeitung dadurch schöner wird, wird behauptet, die Zeitung zeige jetzt noch wahrer „die Welt, wie sie wirklich ist“. Man könnte jetzt feststellen, dass die NW damit näher an die BILD herangerückt ist. Aber auch die F.A.Z. ist schon seit einer Weile täglich bunt und umso mehr man darüber nachdenkt, desto mehr erkennt man, dass Buntheit weder Wahrheit noch Gefälligkeit fördern muss oder kann.)
Wenn es also keine Handlungstechnologie gibt, die Erfolg garantiert, wie geht man vor, wenn man eine wahre oder gefällige Zeitung (um es für das Folgende auf Text zu beschränken) machen will? Die oben genannten Berufsgruppen haben ihre Strategie gefunden. Sie orientieren sich, in zweiter Linie, an der Wissenschaft. Ein praktizierender Arzt, der in erster Linie heilen möchte, orientiert sich in zweiter Linie an wissenschaftlich erworbenem Medizinwissen und orientiert seine Handlungen daran. Ein Richter oder Anwalt, der in erster Linie Recht sprechen will, orientiert sich in zweiter Linie an den wissenschaftlichen Diskussionen und Interpretationen von Rechtstexten. Ein Lehrer, der in erster Linie bilden möchte, orientiert sich in zweiter Linie an der wissenschaftlichen Pädagogik/Psychologie. Die alltägliche Praxis wird durch eine theoretische Reflexion gestützt.
Und ein Journalist, der in erster Linie informieren möchte, was tut er, um sich rückzuversichern? Es gibt nicht nur keine Handlungstechnologie, die seinen Erfolg garantiert, es gibt auch keine seine Tätigkeit begleitende wissenschaftliche Reflexion! Er kann sich nur darauf verlassen, was er (selbst) gelernt hat und was er bei Kollegen erlebt. Es gibt Praxisbücher, die allerdings im Kosmos der Unterscheidung von Gefallen (Textarten & Schreibstile) und Wahrhaftigkeit (Recherchekunst & Presserecht) gefangen bleiben. Es gibt Universitätsstudiengänge, die vor allem aus Üben, Üben, Üben bestehen, die Praxis des Presserechts lehren und die Theorie einer Verständlichkeitsforschung erwähnen. Ohne eine „Journalismuswissenschaft“ gelingt keine ernst zu nehmende Reflexion. (Das Argument ist ein wenig trickreich. Denn eine solche Diskussion gelingt sehr gut innerhalb von Medienhäusern, wenn das Publikum gerade nicht zusieht, wenn am Einzelfall und offen rückblickend über Qualität diskutiert wird. Sie gelingt aber nicht zwischen den Medienhäusern. Eine Professionalisierung im soziologischen Sinne ist somit eigentlich nicht möglich, wenn die Finanzierung über Renommee und Absatz läuft.)
Journalistische Gefälligkeit kann man messen. Die Größe quantifiziert sich beispielsweise im Quartalsergebnis der Axel Springer AG. Was journalistische Wahrhaftigkeit bedeutet, bleibt jedoch, obwohl sich die „Qualitätspresse“ semantisch sehr darauf fokussiert, recht unklar. Jeder der oben charakterisierten Berufe bringt sein eigenes Problem mit sich. Es ist auf der einen Seite unlösbar, sorgt aber in der Diskussion gleichzeitig für die Einheit der Profession. Dem Journalismus fehlt diese wissenschaftliche Berufsbegleitung. Ihm bleiben nur aus Wünschen und Vorstellungen gewonnene, moralisch unterfütterte, in Sonntagsreden beschworene Anforderungen an einen verantwortungsvollen, Demokratie sichernden, guten Journalismus.
Mit einer Ausnahme. Auf schwierige Art und Weise vergeben renommierte Journalismus-Institutionen Medienpreise und veranstalten entsprechende Verleihzeremonien drum herum. Die Auszeichnungen ehren den Ausgezeichneten, sie markieren aber auch die ausgezeichnete Leistung als vorbildhaft und heben sie als Lehrmaterial und Diskussionsgrundlage hervor. Ein Medienpreis und die dazugehörige Veranstaltung stellen die Bühne für, zumindest im gewissen Rahmen, offene Diskussionen und fachliche Reflexionen. Zumindest entscheidet hier eine berufserfahrene Jury und nicht das stets unbestimmbare Publikum. Der und das Ausgezeichnete dienen als praktisches Anschauungsmaterial und die Szenerie bietet den alten Hasen, als Redner, Laudator oder Moderator, die Gelegenheit, unabhängig konkreter Einzelfälle über die Praxis an sich zu sprechen.
Als letzte Woche René Pfister sein Medienpreis verliehen und direkt wieder aberkannt wurde, sah man all das oben beschriebene in einer anschaulichen Situation. Eine Medienpreisverleihung ist eine Reflexionsveranstaltung, die sich keinem wissenschaftlichem Rückhalt bedienen kann und daher mit Pathos, Smokings und Zeremonienprotokoll aufgeladen wird. Der Journalismus hat derart unklare Qualitätsstandards, dass Herr Pfister noch auf der Bühne unbekümmert über seine „Verfehlung“ spricht, ohne sie zu erkennen. Statt im Handbuch nachzugucken, muss man eine komplizierte, außerordentliche Telekonferenz machen, um ihm den Preis wieder abzunehmen. Und soziologisch wäre interessant nachzuvollziehen, wie das eigentlich im Gespräch argumentiert wurde.
Die Erklärung zur Aberkennung des Preises ruht auf der Idee einer journalistischen Anforderung, dass Beschriebenes reproduziertes Erleben zu sein habe und eine konstruierte Erzählung nicht genüge. Frank Schirrmacher weist an dieser Stelle auf die massenmedial etablierten „Helden von Fukushima“ hin. Es ist, das ist klar, auch ohne Geländezugang journalistische Aufgabe, über die Vorgänge in Japan zu berichten. Und es ist klar, dass über diese Vorgänge anschaulich zu berichten ist. Schließlich handelt es sich um einen Vorgang, der als Politikum weltweit zu diskutieren ist. Aber wie könnte man die Lage in Fukushima eigentlich beschreiben, ohne dass im Sinne der Argumentation zur Preisaberkennung Ähnliches drohen würde? Kann man die Vorgänge in Fukushima überhaupt journalistisch beschreiben, ohne dass es „unter Kollegen“ ärger gäbe? Darf es wahrheitsgetreues Storytelling geben? Sollte man das Thema Fukushima auch weiterhin auf bloßer Faktenbasis ohne Erzählung beschreiben?
Oder, für die Anderen gefragt? Wie lebhaft darf ein Geschichtslehrer Geschichte erzählen, wenn er sie nicht leibhaftig erlebt hat? Wie emotional darf die Schmiermasse sein, mit der ein Anwalt rechtliche Argumente, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zusammenhangslos im Buch stehen, zusammenklebt?
Wie anschaulich erzählend darf eine journalistische Reportage sein, die über Jahre gesammelte Fragmente zusammenführt und so, wie erzählt, gar nicht sinnlich erlebt werden kann?
Dem Journalismus fehlen Erfolgstechnologie und Reflexionstheorie. Sollte er sich deswegen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner fesseln lassen und sinnliches Erleben als unabdingbare Bedingung für journalistisches Erzählen fordern? Ich habe aus den oben beschriebenen Servicelücken in Ibis-Hotels keinen Überblick darüber, ob die Woche eine Diskussion darüber entbrannte. Doch ich vermute sehr stark, man hat das Thema schon abgehakt und benutzt es in den Journalismusschulen als Lehrmaterial. Das wäre schade, denn dem kleinen Gewinn, ein Exempel statuiert zu haben, das klar macht, welche Anforderung man an Wahrhaftigkeit hat, steht ein enormer Verlust an nun unausgeschöpftem Potenzial gegenüber, mit dem man eine komplexe Welt journalistisch, also für jedermann, fachlich abgesichert beschreiben könnte.
Ich habe dazu natürlich keine abschließende Meinung (und die darf es ja auch nicht geben, siehe oben) aber ich sehe genügend Anlass darüber zu diskutieren, wo die Grenzen des Journalismus sind (und wo etwa themengleiche Literatur beginnt). So einfach es ist, sinnliches Erleben als Grundlage für journalistisches Beschreiben zu fordern, so sehr ist die Idee, sinnliches Erleben sei ein gesicherter Grund, ein Irrglaube. Oder?

Schreibe einen Kommentar