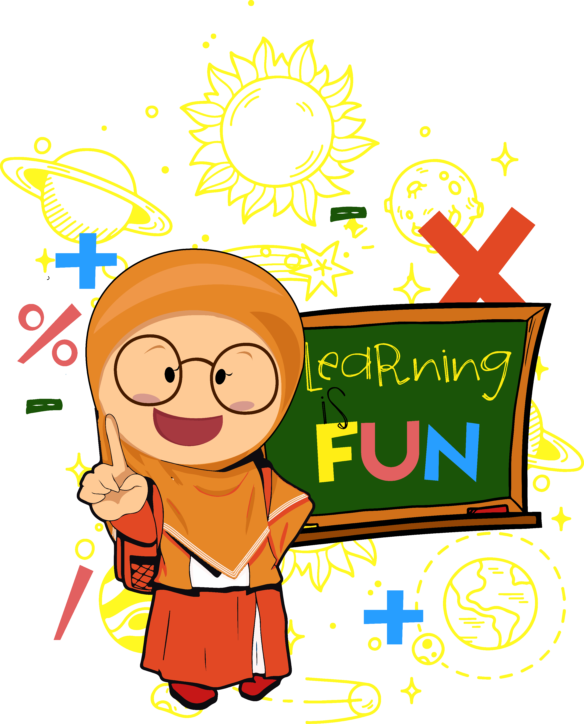 Konsequenzen neuer Managementkonzepte für die Schule
Konsequenzen neuer Managementkonzepte für die Schule
Im Management wird zurzeit von Unternehmen geträumt, in denen Mitarbeiter täglich Sinn stiften. Sie sollten jeden Tag mindestens genauso energiegeladen und erfüllt nach Hause zurückkehren, wie sie am Arbeitsplatz erschienen sind. Dafür müssten die Mitarbeiter Freude an der Arbeit haben und sich dabei als Menschen mit all ihren Gefühlen begegnen.
Das Zielbild für diesen aus den USA herüberschwappenden Managementtrend ist das einer „Purpose Driven Organization“ – einer durch Sinnhaftigkeit getriebenen Organisation. Der Gedanke ist simpel. Wenn eine Organisation einen attraktiven Zweck hat – die Rettung der Umwelt, die Verbesserung des menschlichen Zusammenlebens oder den Weltfrieden – würden Mitarbeiter größere Freude an der Arbeit empfinden und so die Leistungsfähigkeit der Organisation steigern.
Begrenzte Zweckidentifikation von Schülern
Die Verfechter der „Purpose Driven Organization“ begründen ihre Forderung nach einer neuen Form der Arbeit mit den veränderten Erwartungen jüngerer Mitarbeiter an das Arbeitsleben. Die Generation Y, die in den 1980er und 1990er Jahren geboren worden sind, würden sich nicht mehr reibungslos in Organisationen einfügen lassen, sondern konsequent die Frage nach dem Warum – dem „why“ – ihrer Tätigkeit stellen. Ohne eine klare Antwort auf die Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeit, sei diese Generation nicht mehr zu motivieren.
Aus einer bildungspolitischen Perspektive fällt jedoch auf, dass die Generation in einer Schule sozialisiert wurde, in der die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Lernens auffällig wenig diskutiert wird. Lehrpläne richten sich nicht danach aus, was Schüler selbst als sinnvollen Lernstoff empfinden und der Spaß am Lernen wird in den wenigsten erreicht. Leiter einer Regelschule, die behaupten würden, dass in ihrer Schule die Schüler die Sinnhaftigkeit des Lernpensums erkennen und mit großer Freude lernen würden, unterliegen einer für ihre eigene Motivation funktionalen, aber an der Realität vorbeigehenden Selbsttäuschung.[1]
Sicherlich, immer wieder berichten Schüler von Phasen nahezu euphorischen Lernens. Auffällig ist jedoch, dass dies in der Regel personell auf einzelne Lehrerinnen und Lehrer zugerechnet wird. Es ist eine bestimmte Mathematiklehrerin oder der eine Geschichtslehrer, die die Freude an einem Fach geweckt haben. Aber schon durch die personelle Zurechnung wird deutlich, dass diese positiven Lernerfahrungen die Ausnahme sind. Mit Blick auf die Strukturen von Regelschulen hat man eher das Gefühl, der Effekt ist, dass den Schülern systematisch die Freude am Lernen ausgetrieben wird. Aber vielleicht liegt darin gerade die zentrale Sozialisationsfunktion von Schulen.
Die Sozialisation für Tätigkeiten in Organisationen
Schon der US-amerikanische Bildungsforscher Robert Dreeben hat darauf aufmerksam gemacht, dass es in Schulen nicht primär darauf ankäme, die korrekte Deklination der Reflexivpronomen, die Grundlagen der Hydrogeographie oder die Prinzipien der anorganischen Chemie zu lernen. Viel bedeutender sei es zu lernen, dass das Leben in Organisationen ganz anders funktioniert als in der vertrauen Familie. Erst in der Schule würden Schüler begreifen, dass sie nicht als ganze Person wahrgenommen werden, sondern auf ihre Rolle als Schüler reduziert werden. Sie lernen, dass eine Rolle wie die des Lehrers durch Personen ganz unterschiedlich ausgeübt werden kann und es trotzdem möglich ist, allgemeine Aussagen über Lehrer zu treffen. Sie erfassen, dass sie anders als in der Familie nicht bedingungslos geliebt werden, sondern nach standardisierten Kriterien mit Gleichaltrigen verglichen und beurteilt werden.[2] Kurz: Die Sozialisation der Schüler im Hinblick für spätere Tätigkeit in Organisationen ist wichtiger als die Erziehung zur Beherrschung eines genau definierten Lehrstoffes.[3]
Die Schule bereitet Schüler systematisch auf die Anforderungen an Interaktionsgeschicklichkeiten in Organisationen vor. In der Schule erfahren Kinder erstmals, dass es Interaktionen gibt, zu deren Inhalten sie wenig Verbindung herstellen können, die sie aber nicht vermeiden können. Sie lernen, diese Entfremdung in der Interaktion zu ertragen, wenn nötig gegenüber den Lehrern Interesse am Stoff zu heucheln und zur Herstellung der Solidarität mit den Mitschülern immer wieder auch Distanz zu ihrer Rolle als Schüler durchschimmern zu lassen. Sie lernen, dass es zur Rolle einer Lehrerin oder eines Lehrers gehört – zum Beispiel bei Hinweisen auf Lernrückstände oder Begabungslücken – in der Interaktion mit Schülern taktlos zu sein, es aber gleichzeitig sinnvoll sein kann, auf das rollenbedingte taktlose Verhalten des Lehrers taktvoll zu reagieren.[4]
Neue Lernfelder in der Schule
Wenn es stimmt, dass immer mehr Unternehmen sich auf die Suche nach einem Zweck begeben, der mit den Mitarbeitern ein sinnhaftes und spaßbetontes Arbeiten ermöglicht, dann müsste die Sozialisation in der Schule grundlegend geändert werden. Als Kompetenz wäre nicht mehr das Ertragen von Entfremdungserfahrung in Interaktionen, das Akzeptieren von Taktlosigkeit sowie Fertigkeiten im Zeigen und Unterdrücken von Rollendistanz zu vermitteln. Angesagt wären eher Fähigkeiten in der Handhabung von allzu stimulierenden Organisationserfahrungen, das Erlernen von Takt in einem auf die ganze Person ausgerichteten Umgang und die Mäßigung einer durch die Freude am Lernen bedingten allzu großen Rolleneuphorie.
Diese Neuausrichtung der Sozialisationsfunktion von Schulen wäre nur durch grundlegende Umstellungen in der Organisation Schule zu erreichen. Das Lernen müsste aus dem Korsett von 45-minütigen Unterrichtsstunden gelöst und projektförmig organisiert werden. Lehrpläne, die durch ihren immer größeren Detaillierungsgrad die Gestaltungsmöglichkeiten der Lehrer stark begrenzen, dürften nur noch als grobe Orientierungsrahmen dienen, in denen Lehrer und Schüler ihre Lernziele selbst definieren. Noten, die für viele Schüler im Laufe ihrer Schulkarriere zum zentralen Motivationsfaktor werden, müssten abgeschafft werden, weil sie vom Spaß am Lernen ablenken.
Aber die Bildungspolitiker der Länder und die Schulplaner in den Kultusbehörden können beruhigt sein. Es zeichnet sich deutlich ab, dass Unternehmen, die sich auf einem „Purpose Quest“ befinden, vorrangig damit beschäftigt sind, ihre Fassaden weiter aufzuhübschen. In Hochglanzbroschüren, Internetvideos und auf Websites wird den Mitarbeitern eine neue Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeit verkündet, ohne dass sich an der Produktpallette, den Arbeitsformen oder Motivationsmitteln etwas grundlegend ändern würde. Der zentrale Lerneffekt der Maßnahmen zur Sinnstiftung in Unternehmen besteht für die Mitarbeiter darin, dass es notgedrungen eine Diskrepanz zwischen der Schauseite einer Organisation und den realen Arbeitsverhältnissen gibt.
Insofern bietet die in den Schulen populäre Erstellung von Leitbildern den Schülern neue Lernchancen. Sie können begreifen, dass die Forderung nach einem wertschätzenden gegenseitigen Helfen nicht bedeutet, dass man die Mitschülerin in einer Klausur abschreiben lassen darf, dass die Förderung der Individualität als Teil der Persönlichkeitsbildung nicht heißt, dass man in der Schule individuelle Lernschwerpunkte abseits des Lehrplans legen kann und dass die postulierte Anerkennung individueller Stärken und Schwächen nicht bedeutet, dass grundlegende Probleme eines Schülers mit den lateinischen Konjugationsklassen, der mathematischen Funktionalanalyse oder der physikalischen Thermodynamik geduldet werden.[5] Die unmittelbare Erfahrung einer solchen Diskrepanz zwischen dem wohlklingenden Wertekatalog einer Schule und der harten Realität im Schulalltag bereitet Schüler also konsequent darauf vor, was sie später in Organisationen erwartet.
Stefan Kühl ist Professor für Organisationssoziologie an der Universität Bielefeld und arbeitet als Senior Consultant für die Firma Metaplan.
[1] Statt auf empirische Studien zum geringen Spaß von Schülern an der Schule zu verweisen, sei auf die prominente Behandlung der „Frage „Warum ist die Schule doof?“ im Band 1 der Kinder-Uni verwiesen. Siehe Ulrich Janßen/Ulla Steuernagel, Die Kinder-Uni 1. Forscher erklären die Rätsel der Welt, München 2008, 183ff.
[2] Siehe dazu Robert Dreeben, Was wir in der Schule lernen, Frankfurt a.M. 1980, 59ff.. Dreeben spielt hier systematisch die Pattern Variables Talcott Parsons durch. Siehe dazu auch Jürgen Kaube, Bildung nach Dreeben, in: Zeitschrift für Pädagogik 52 (2006), S. 11–18. Der Text findet sich in: Jürgen Kaube, Im Reformhaus. Zur Krise des Bildungssystems, Springer 2015, S. 37–54.
[3] Zum Unterschied von Sozialisation und Erziehung siehe Niklas Luhmann, Sozialisation und Erziehung, in: Niklas Luhmann (Hrsg.), Soziologische Aufklärung, Opladen 1987, S. 173–181.
[4] Die Lernmöglichkeiten in Schulen in Bezug auf Interaktionsanforderungen in Organisationen sind noch nicht systematisch herausgearbeitet worden. Zum Konzept der Entfremdung in Interaktionen siehe Erving Goffman, Alienation from Interaction, in: Human Relations 10 (1957), S. 47–59; zu dem der Rollendistanz siehe Erving Goffman, Role Distance, in: Erving Goffman (Hrsg.), Encounters. Two Studies in the Sociology of Interaction, London 1961, S. 73–134; zu Takt und Taktlosigkeit Niklas Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, Berlin 1964, S. 358–363.
[5] Die Beispiele stammen aus dem Leitbild des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Quickborn, das sich nicht grundlegend von Leitbildern beliebig anderer Gymnasien unterscheidet. Siehe http://www.dbgq.org/unsere-schule/leitbild/.

Schreibe einen Kommentar