
Und es gibt ihn doch. Entgegen anderslautenden Gerüchten, Behauptungen und Lehren, spielt der Mensch in der Gesellschaft eine Rolle — auch in der systemtheoretischen Lesart. „Für soziale Systeme sind Menschen unverzichtbar“, heißt es von Peter Fuchs, der die kryptischen Theoriebausteine kennt: die Gesellschaft bestehe aus Kommunikation und auch nur diese könne kommunizieren. Peter Fuchs ist allerdings auch mit Niklas Luhmanns Fußnotenhumor vertraut. Man dürfe nämlich sehr wohl in der systemtheoretischen Soziologie über den Menschen etwas sagen, wenn man nur dazu sagt, welchen man meint. Bei einem Theorieschmöker, der „Luhmann Handbuch” heißt, liegt es auf der Hand – es geht um Niklas Luhmann. Eigenen Humor bewiesen die zahlreichen Herausgeber aber auch. Nach 440 Seiten lautet der letzte Satz: „Luhmann ist ein Teil, wenn auch nur ein kleiner Teil, des intellektuellen Cocktails, der sich selbst ,Theorie‘ nennt.” Der Dreiklang des Untertitels „Leben, Werk, Wirkung“ ist hier längst ununterscheidbar.
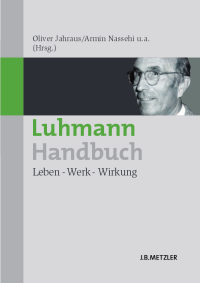 Dass das in Luhmanns Sinne ist, zeigt wieder Peter Fuchs schon auf knappen drei Seiten zu Beginn, auf denen es um die Person Niklas Luhmann geht, die sich hinter der Theorie versteckt. Sollten, zitiert Fuchs Luhmann, nach der Lektüre seines soziologischen Werks Fragen über das Leben und Denken desjenigen offenbleiben, der die Schreibleistung erbrachte habe, so hätte der Autor schlecht geschrieben. Dieser Rückzug allerdings, befindet Fuchs, folgt einem Kalkül, weswegen er den Biographieverzicht Luhmanns nicht als Beiläufigkeitsphänomen hinnimmt, sondern mit einer „Unkenntlichkeitsbiographie“ quittiert. Es beginnt also mit einer Paradoxie. Die Theorie, die von Autoren nichts wissen will, ist gerade auf einen besonders angewiesen, der sich mit seinem bewusst gepflegten „Habitus der Unnahbarkeit und Unkenntlichkeit“ selbst als Ironiker auszeichnete, schreibt Fuchs. Für die Theorie bleibt dieser Befund nicht folgenlos, ebenso wenig für dieses Handbuch zur Theorie.
Dass das in Luhmanns Sinne ist, zeigt wieder Peter Fuchs schon auf knappen drei Seiten zu Beginn, auf denen es um die Person Niklas Luhmann geht, die sich hinter der Theorie versteckt. Sollten, zitiert Fuchs Luhmann, nach der Lektüre seines soziologischen Werks Fragen über das Leben und Denken desjenigen offenbleiben, der die Schreibleistung erbrachte habe, so hätte der Autor schlecht geschrieben. Dieser Rückzug allerdings, befindet Fuchs, folgt einem Kalkül, weswegen er den Biographieverzicht Luhmanns nicht als Beiläufigkeitsphänomen hinnimmt, sondern mit einer „Unkenntlichkeitsbiographie“ quittiert. Es beginnt also mit einer Paradoxie. Die Theorie, die von Autoren nichts wissen will, ist gerade auf einen besonders angewiesen, der sich mit seinem bewusst gepflegten „Habitus der Unnahbarkeit und Unkenntlichkeit“ selbst als Ironiker auszeichnete, schreibt Fuchs. Für die Theorie bleibt dieser Befund nicht folgenlos, ebenso wenig für dieses Handbuch zur Theorie.
Den Text über Autopoiesis, der das Begriffe-Kapitel mit dreißig Stichwörtern eröffnet, schreibt keiner jener etablierten Soziologen, die sich allen anderen zentralen Begriffen und Werke zuwenden, sondern die junge Münchner Wissenschaftlerin Iryna Klymenko. Dass der Begriff der Biologie entlehnt sei, etwas mit Reflexion aber nichts mit Psyche zu tun habe und „vielmehr die Denkvoraussetzung der ganzen Theorie“ sei, lernen wir in diesem Text abermals, ohne auch diesmal zu verstehen, was es mit ihm nun tatsächlich auf sich hat. Als müsste man ein weiteres Mal ungewollt beweisen, dass sich die Systemtheorie nicht in enzyklopädische Schnipsel zerlegen lässt, sind es die Texte über Kommunikation (Peter Fuchs), Sinn (Christian Kirchmeier), System und Umwelt (Jasmin Siri) und Zeit (Armin Nassehi), die sich gemeinsam der Autopoiesis annehmen.
***
Um sich nicht selbst mit der Gesellschaft zu verwechseln, unterscheiden soziale Systeme fortlaufend zwischen sich und ihrer Umwelt. Sie versuchen zu verstehen, wer sie sind und was sie nicht sind, und kommunizieren dafür. Über ihre Umwelt erfahren sie dadurch nichts. Wenn sie sich bemühen, nur für sie Unwichtiges zu vergessen, lernen sie mit der Zeit allerdings sich selbst kennen. Wollte man das inflationär verwendete Wort „Konstitution“ vermeiden, beließe man die Autopoiesis-Definition bei der Selbstfindungsmechanik sozialer Systeme, die nichts anderes können, als Kommunikation an Kommunikation zu knüpfen und dabei immer unter ihren Möglichkeiten bleiben.
Ein Gespräch am Mittagstisch könnte immer noch etwas interessanter sein, als es gerade ist – zusammenhanglose Themenwechsel sind trotzdem nicht gestattet. Unternehmen könnten bessere Facharbeiter haben – können aber immer wieder nur über vorliegende Bewerbungen entscheiden. Das Wirtschaftssystem weiß nicht, wann es das Politiksystem in eine Krise stürzt – Zahlungen wird es aber in jedem Fall weiterhin geben.
***
Aber was macht man mit dieser Einsicht in die Denkvoraussetzung der ganzen Theorie, dass die Gesellschaft und alle anderen sozialen Systeme unbelehrbar tun, was sie nach selbst entwickelten Maßgaben tun, ohne je zu erfahren, was um sie herum tatsächlich geschieht? Moralische Aufklärung bietet die Theorie nicht, intellektuelle allerdings schon. Lehrreicher als das enzyklopädische Kapitel ist die anschließende Werkschau, in der namhafte Autoren 24 Werke Luhmanns rezensieren, nachdem in zwei Kapiteln Grundlagen und Theoriestränge behandelt wurden und bevor in anschließenden Kapiteln Bezüge zu und Rezeptionen durch weitere Disziplinen aufgezeigt werden. Ob der Einzelne mit diesem Buch besser durch die soziologische Systemtheorie findet, lässt sich kaum sagen. Aber auf die Frage, mit welchem Buch man beginnen sollte, ist es eine hervorragende Antwort. Denn trotz seines enzyklopädischen Charakters, ist es ein gelungenes Lehrbuch, dass sich zur zentralen Aufgabe nimmt, Soziologie als Handwerk ernst zu nehmen.
Beispielhaft dafür ist der Bielefelder Soziologe Klaus-Peter Japp mit einem auf Anhieb verständlichen Text zur Soziologie des Risikos. Es gehe gar nicht um Wahrscheinlichkeiten, mit denen sich etwas Schädliches vermeiden lasse, sondern um eine Unterscheidung zur Gefahr. Risiken sind Folgen von eigenen, Gefahren Folgen von fremden Entscheidungen. Wer selbst entscheidet, bedauert. Wer von den Entscheidungen anderer betroffen ist, leidet. Das war’s! Es sei darüber hinaus „keine Begriffsakrobatik“ notwendig, um sich mit dem Folgenreichtum dieser Risiko-Perspektive zu befassen, schreibt Japp und wendet sich ihm zu:
Die moderne Gesellschaft nehme sich selbst gefangen von unausweichlich tragischen Entscheidungen, die sich wegen akuter Zeitnot und ständigem Wissensmangel nie rational und erst recht nicht vernünftig treffen lassen. Die Fortentwicklung des Gewollten in Erreichtes bedarf ständig nächster Schritte in eine unbekannte Zukunft. Wollte man Risiken vermeiden, bekäme man es mit einer enormen Planfeststellungsbürokratie zu tun. Ließe man zu viel Risiko zu, setzten plötzlich systemrelevante und alternativlose Teile das Ganze aufs Spiel. Sicherheit gibt es in diesem Evolutionstheater nicht. Dafür stellt die Wissenschaft viel zu wenig gesichertes Wissen her, im Verhältnis zum von ihr unbeabsichtigt erzeugten Nichtwissen. Rettung durch Technologien bleibt frommer Wunsch, mit „Ausbrüchen ins Katastrophale“ sei immer zu rechnen. Das berühmte Restrisiko ist eben doch nur ein sperriger und falscher Begriff für unberechenbare Gefahr. So einfach kann Soziologie sein.
(Bild: Tommy Clark)

Schreibe einen Kommentar