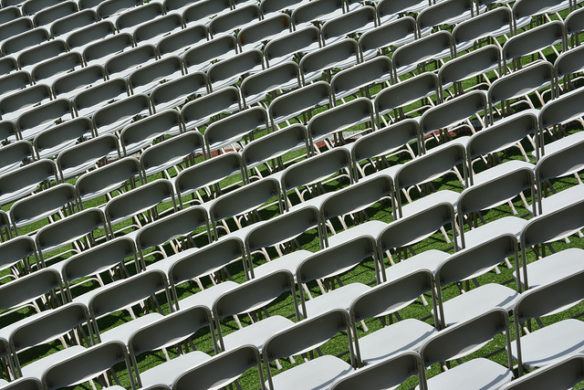
Von Marcel Schütz und Lukas Daubner*
In der Universität gibt es derzeit eine große Erzählung: vom Defizit ihrer Lehre. Marginalisiert erscheine sie, für wissenschaftliche Karriere praktisch unnütz. Wo man auch hinhört, pessimistischer Grundton. Diesem Mangel, heißt es, sei mit strategischer Tatkraft zu begegnen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft will neuerdings nebenher „Lehrgemeinschaft“ heißen. In den Hochschulen feilt man an „Lehrstrategien“. Das wundert nicht, empfiehlt der Wissenschaftsrat doch ganze „Lehrverfassungen“ – Lehre landauf, Lehre landab. Bei alledem schwingen gut verdeckte Vorurteile mit: Zu wenig engagiert, wenn nicht gar schlecht werde gelehrt. Man empfiehlt, was seit Jahrhunderten anscheinend sträflich vernachlässigt wurde: vermehrt Lehrangebot für Lehrende, auf dass sie verstehen, was sie tun und erloschener Elan neu entfacht werden möge.
Der tatsächlichen Entwicklung der Hochschullehre wird diese Defizitdiagnostik nicht gerecht. In den letzten fünfzig Jahren ist eine enorme Expansion von Hochschultypen, Fakultäten und Studiengängen vonstattengegangen, die nicht nur eine stark diversifizierte studentische Nachfrage zur Folge hatte, sondern zur flächendeckenden Institutionalisierung der Hochschuldidaktik bzw. überhaupt zur besonderen Fokussierung auf die Lehre führte. Die Gründung der Fachhochschule – von der ursprünglichen Idee her eine quasi-akademische „Berufsschule“ – trug dieser Entwicklung prominent Rechnung. Alle Hochschulen haben Anstrengungen unternommen, auf eine rasch wachsende, politisch geförderte Nachfrage differenziert zu antworten. Zugleich ist es der Universität gelungen, ihren originären Lehrbetrieb zu bewahren: Vorlesungen als instruktive Information über das Proprium des Faches sowie vertiefende Lehrgespräche in Form der Seminare.
Die Früchte dessen, einschließlich immer neuer hochschuldidaktischer Reflexionsschleifen, sind überall zu genießen. Neben Referaten in den Hochschulpräsidien sowie Instituten, Koordinations- und Beratungsstellen der Fakultäten, finden sich in akademischen Verbänden und Graduiertenschulen viele lehrspezifische Angebote. Unter solch günstigen Bedingungen könnten die Verfechter einer noch viel besser bedachten Lehre sehr zufrieden sein. Gerade der Nachwuchs dürfte unter diesem Einfluss sich mit eigener Lehrtätigkeit sensibler befassen als frühere Generationen.
Drei Typen didaktischer Defizienzbeschreibung
Allgemein sortiert – wenngleich nicht trennscharf –, sind drei Typen didaktischer Defizienzbeschreibung zu bestimmen. Aus einer vorwiegend methodischen Richtung wird der organisatorische Ablauf der Lehre adressiert. Den methodischen Vertretern fehlt es an Ausstattung, an Technologiewechsel, an Bereitschaft sich „zeitgemäßen“ Formen der Vermittlung zu öffnen. Lehrende, die mit PowerPoint-Folien sparsam sympathisieren, ihre Seminare überwiegend mit einem Papierstapel beginnen und beenden, geraten schnell unter den Verdacht, altmodisch zu sein. Auch der rhetorisch anspruchsvoll dargebotene aber methodisch mangelhafte Vortrag erfahrener Ordinarien wird davon nicht ausgenommen.
Etwas andersartige Anliegen verfolgen die politisch Ambitionierten, denen es um Emanzipation des Einzelnen oft problematisch bestellt scheint. Ihre – u. a. studentischen – Anhänger kritisieren die Hierarchie in der Lehre. Aber es geht ihnen um mehr als Fragen der Sitzordnung. Das Misstrauen gilt ebenso den Curricula; was sie mitunter dazu (ver-)führt, sich bei ihrer Kritik speziell auf Lehrpersonen einzuschießen. Die Lehrenden werden als Menschen zum „Problem“, ihrem „wahren“ Denken, geheimen Werturteilen etwa, ist gründlich nachzuspüren. So liest man z. B. ihre Schriften und meint darin auf verdächtig-andeutsame Formulierungen zu stoßen. Und in manch hergebrachten Marotten der Lehrenden lässt sich sowieso viel Despektierliches wähnen. Personalisierung – das Defizit der Person als Defizit der Lehre – scheint hier besondere Relevanz zu erfahren.
Das Thema der dritten Gruppe ist der genuin akademische Gehalt der Lehre. Sie ahnt, wo überall Niveausenker lauern. Eine gewisse Ungeduld im Umgang mit nicht auf Anhieb vorbildlich räsonierenden Studierenden ist durchaus festzustellen. Was den methodischen Kritikern besonders stark auf den Nägeln brennt, veranlasst Traditionalisten kaum zu einer Regung. Ihr Klagen rührt aus dem Eindruck einer vermassungsbedingten Verhinderung anspruchsvoller Lehre. Nicht nur, dass die Veranstaltungen immer größer geworden sind, der Andrang einer heterogenen Klientel sorgt für Unmut. Ginge es nach einigen von ihnen, würde man die Universitätslandschaft am besten in eigens erkorene Forschungsstätten und restliche, überwiegende „Lehrhochschulen“ für die breite Masse gliedern. So befürworten sie, ausgesprochen oder nicht, Niveaudifferenzierung, vorausgesetzt die Forschung profitiert davon.
Nicht zuletzt eine penetrante Diskussion um die „Exzellenzforschung“ dürfte zu einem Missverhältnis von Forschung und Lehre insgesamt beigetragen haben. Denn die irreführend einseitige Betonung der Forschung erklärt den seit einiger Zeit vorherrschenden Aktionismus in Hochschulen: Das klangvolle Konstrukt der empirischen „Exzellenz“ ist durch das einer rhetorisch weichgespülten „guten Lehre“ ergänzt worden; einer Lehre, die wohl vor allem dann als „gut“ gilt, wenn man mit ihr nirgends mehr aneckt und bloß nicht gegen den Strich bürstet. Das gewollte Bewerben der „guten Lehre“ (welche Lehre war die „schlechte“?) beruht auf dem Missverständnis, Professionalisierung dadurch zu erreichen, dass man einen selbst erzeugten Kontrast notdürftig wieder zu korrigieren sucht.
Dabei drängt sich allerdings der Eindruck auf, dass das Begehren nach Besserung der Lehre umso lauter vorgetragen wird, je mehr dieselbe Beachtung gefunden hat. Kurz gesagt: Je mehr der Lehre Gutes getan wird, desto mehr werden angebliche institutionelle Mängel behauptet. Ganz einfach deshalb, weil die Universität in eine selbstgestellte Falle eigener Überfokussierung getappt ist: Die andauernde Problematisierung fußt auf der propagierten Spaltung von Lehre und Forschung. Tatsächlich hat sich eine wissenschaftsvergessene Euphorie der Exzellenz von der Einheit von Forschung und Lehre immerhin für die „breite Masse“ weithin verabschiedet. Damit das so bleibt und von der schrittweisen Exklusion der Forschung keiner abrückt, werden hier und da schöne Worte für eine angeblich noch viel schöner werdende Lehre spendiert – eine Fassade, die dazu dient, der eigentlich längst gefestigten Spaltung das nötige Maß Legitimation zu verschaffen.
Lehre als Organisationsproblem
Dass Lehre als Organisationsproblem verstanden wird, ist ohnehin ein neues Phänomen. Mit dem reformerischen Impetus, Universitäten als Organisationen optimieren zu müssen, geht die Vorstellung einher, dass Forschung und Lehre letztlich „Produkte“ seien, die planvoller Herstellung und Steuerung bedürften. Lehrende sollen dann durch Strategien und Leitbilder angehalten werden, sich besser beobachtbar zu machen. Diesen Anstrengungen steht entgegen, was der Soziologe Niklas Luhmann und der Pädagoge Karl-Eberhard Schorr als „Technologiedefizit“ beschrieben haben. Jeglicher Unterricht geht unvermeidlich mit der Schwierigkeit einher, die invisiblen Lernprozesse jedenfalls nicht kausal-linear strukturieren zu können. Dieses Steuerungs- oder Organisationsdefizit lässt sich nicht vermeiden, es beeinflusst und beeinträchtigt die (Un-)Möglichkeiten des Unterrichts (wie und was tatsächlich gelernt wird) dauerhaft mit. Unter welchen Bedingungen Lehre erfolgreich ist, lässt sich nicht eindeutig vorhersagen. Daher müssen sich Lehrende regelmäßig mit Alltagsbeobachtung, Erfahrung und Intuition behelfen.
Davon scheint das zunehmende Bedürfnis, für Lern(miss-)erfolge dennoch primär Lehrende – und weniger erwachsene Lernenden – verantwortlich zu machen, kaum gestört zu werden. Viel naheliegender ist es en vogue, omnipräsent von „Kompetenzorientierung“ zu sprechen, die damit zum Credo einer überdidaktisierten Lehre gemacht wird. Gerade ein modularisiertes Studiendesign prägt diese Hoffnung auf sichere Haltegeländer wesentlich mit. Und die Verankerung dieser Haltegeländer bewirkt einen Konflikt mit der Wissenschaft: Wissenschaft, so Luhmann, macht nicht sicher, sondern noch unsicherer. In der Ambivalenz von akademischem Selbstanspruch der Forschung einerseits und überdidaktisierten Erwartungen andererseits, liegt das intellektuelle Problem der „Gute Lehre“-Optimierung: Unter einer Leerformel werden wichtige Grenzen schulischer und tertiärer Bildung verwischt; soweit bis alle wieder zu Schülern werden; verbunden mit dem Anspruch, dass die Universität für den Erfolg oder Nichterfolg der Studierenden weitgehend Verantwortung zu tragen habe. Dieser Umstand führt dazu, dass ein Ideal der Lehre unter genauer Aufgliederung von Kompetenzen beschworen wird, anstatt es auf produktive „Interaktionsturbulenzen“ ankommen zu lassen. Die Vorstellung von der guten Lehre marginalisiert das Widersprüchliche, das Irritierende, das Unwägbare. Und wenn Kompetenzorientierung im Studium sein muss, weshalb dann nicht am ehesten die des sichereren Umgangs mit Unsicherheit? Dazu gehört das Aushalten und Bewältigen einer Flut an Entscheidungsproblemen, wie sie für die Gesellschaft, in der die Universität existiert, nun einmal typisch sind.
Mehr Ehre für die Lehre
Letztlich eint die Lager der Kritik dieselbe Herangehensweise: sie ergänzen sich in ihrer eindimensionalen, ambivalenzbereinigten Problembeschreibung und verklären eine gewisse Normalität didaktischer „Unordnung“ zum kapitalen Institutionsdefizit: Es fällt nicht schwer, überall eine digitale Wüste zu sehen, wenn man die Überzeugung voranstellt, die Digitalisierung der Lehre sei das Maß aller Dinge. Und es fällt nicht schwer, eine ungenügende Einbindung von Studierenden zu monieren, wenn eine Neigung besteht, in organisierten Apparaten überall Demokratie- oder Partizipationsdefizite sehen zu wollen. Lehr-Kritik hat gewiss den Charme, dass die Zuspitzung auf bestimmte Mängel für Hochschulreformdebatten anschlussfähig daher kommt. Denn anders als die Forschung, geschieht die Lehre weitaus sichtbarer vor Publikum. Sie bietet eine Angriffsfläche, da das, was sie leisten will, mit Bekanntem verbunden werden kann: vor allem Schulen, über die ja auch jedermann zu wissen glaubt, was ihre Probleme sind. So werden monokausale und monorationale Defizienzbeschreibungen bevorzugt, die aber eine unvoreingenommene Diskussion der Ansprüche und Bedingungen der Hochschullehre blockieren.
Die bemerkenswerte, buchstäblich problematische Aufmerksamkeit, die die Lehre genießt, dient wohl häufig der Bestätigung normativer Festlegungen. Sollte man mit der universitären Lehre aber weiterhin das Ziel verfolgen, Irritationen auszulösen, statt sie von vornherein meiden und die Erwartungen akademischer Neuankömmlinge möglichst nicht stören zu wollen, wird nicht hauptsächlich auf methodische Raffinesse, Emanzipationsgeist und Niveaudifferenzierung zu setzen sein. Wenn es nicht allein zum Wesen universitärer Festreden gehört, Einheit von Forschung und Lehre zu verkünden, erscheint es uns angezeigt, die seltsame Rhetorik didaktischer Insuffizienz aufzugeben. Mehr – wie es heißt – „Ehre“ für die Lehre gibt es dort, wo mit der Lehre zugleich Forschung und in der Forschung zugleich Lehre vollzogen werden. Darin (und einzig darin) ist der Charakter der Universität zu finden. Preise, Pakte und Programme zum Zweck vermeintlicher Revitalisierungen mögen zwar als aufhübschendes Beiwerk nicht schaden – für die Qualität der Lehre bleibt ihre Relevanz gleichwohl überschaubar.
*Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Langfassung des am 12.10.2018 in der NZZ erschienen Artikels „Mehr Ehre für die Lehre – die Universitäten sollten ein Ort produktiver Unruhe sein“.

Schreibe einen Kommentar