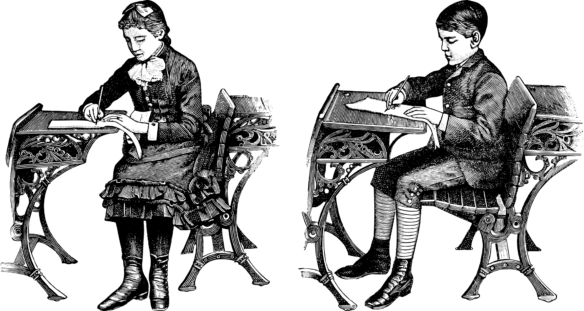
Fast alle haben eine Meinung dazu, wie man Schulen besser machen kann. Schulen sind der einzige Organisationstyp, in dem noch eine Zwangsmitgliedschaft besteht und deswegen hat jeder – je nach eigener Schulkarriere – 9000 bis 15000 Stunden Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, wie Schulen funktionieren, wie man da am besten durchkommt und wie man sie verbessern könnte. Über Verbesserung von Armeen, Gefängnissen oder Ministerien machen sich nicht so viele Gedanken, weil die wenigsten diese aus eigener Erfahrung kennen.
Für Bildungspolitiker, Schulverwaltungen, Leitungsebenen und Lehrer ist dies keine einfache Situation, weil sie von unterschiedlichen Seiten mit Verweis auf eigene Erfahrungen mit Ansprüchen konfrontiert werden. Es ist nicht nur wie beim Fußball, wo wir es mit Millionen potentiellen Nationaltrainern zu tun haben, die den Anspruch haben, zu wissen, was man anders machen sollte, sondern im Fall der Schule, darauf verweisen, dass man den Apparat ja aufgrund Tausenden von Stunden aus eigener Anschauung sehr genau kennt.
An mehr oder minder durchdachten Reformvorschlägen, wie man Schule besser machen sollte, mangelt es deswegen nicht: Man könnte den Unterricht später beginnen lassen, damit die Schüler ausgeschlafener sind. Das Personal müsste besser ausgewählt werden, so dass man nicht unter unfähigen Lehrern zu leiden hat. Man bräuchte stärkeren Praxisbezug, damit Schüler auch begreifen, weswegen sie in die Schule gehen. Benötigt würde größere Digitalkompetenz, damit Schüler Computer nicht nur als Abspielgeräte für Videos begreifen.
Die Leistungserbringung im Klassenraum
Die Herausforderung für eine Veränderung von Schulen besteht darin, dass die Vermittlung der Inhalte im Unterricht stattfinden. Es sind die alltäglichen Interaktionen zwischen Lehrern und Schülern im Klassenraum, in denen Inhalte vermittelt werden. Es mag vorkommen, dass Schüler sich vor einer Unterrichtsstunde zu Hause allein vorbereiten und danach die verlangten Hausarbeiten erledigen, aber die Entscheidung, ob Inhalte verstanden werden oder nicht, finden im Unterricht statt. „Gute Schule“ besteht zu großen Teilen aus „gutem Unterricht“.
Das Problem ist, dass man über keine Techniken verfügt, mit denen man in Interaktionen das Wissen in die Köpfe von Schülern bringen kann. Das hängt nicht damit zusammen, dass nicht ausreichend Gelder in die Unterrichtsforschung geflossen sind, sondern das Lernprozesse auf die Mitwirkung von Schülern angewiesen sind. Schüler sind aber in ihren Bedürfnissen heterogen, reagieren auf verschiedene Lehrertypen sehr unterschiedlich und werden stark von den Eigendynamiken in den Klassenrauminteraktionen beeinflusst. Interaktion im Unterricht lässt sich also nicht in der gleichen Form standardisieren wie die Aufnahme von Kundenbeschwerden im Call-Center oder das Verkaufsgespräch im Hamburger-Restaurant.
Das, was in den Unterrichtsstunden in den Schulklassen stattfindet, ist für alle Außenstehenden – Bildungsverwaltung, Schulleitung, Eltern – eine Blackbox. Man mag versuchen in Lehrplänen genau vorzugeben, was in jeder Unterrichtsstunde gemacht werden muss, regelmäßige Hospitationen im Unterricht durchführen oder Videokameras zu Überwachung von Lehrern und Schülern installieren – das was im Unterricht stattfindet, wird durch einen Lehrer als Einzelkämpfer mit seinen Schülern von Stunde zu Stunde ausgehandelt. Die einzige Einflussmöglichkeit besteht darin, über die Setzung von Rahmenbedingungen auf die Schule einzuwirken.
Der Autonomiegewinn der Schulen
Vor einigen Jahrzehnten wäre der Adressat für die Probleme in der Schule die Bildungspolitik gewesen. Früher wurde genau von oben vergleichsweise genau vorgegeben, von wann bis wann der Unterricht stattzufinden hat, in welchen Zeitblöcken der Unterricht einzuteilen ist und was in einem Jahr in einer Schulklasse zu unterrichten ist. Das didaktische Modell in der Bundesrepublik Deutschland war dabei dem Modell der DDR gar nicht so unähnlich, in der vorgegeben wurde, welche Inhalte in einer Schulstunde zubehandeln sind und welches Schaubild am Ende an der Tafel zu stehen hat.
Auch wenn es eine hohe Varianz geben mag, dominierte doch die Vorstellung, dass die Bildungspolitik am besten weiß, wie Schule zu organisieren ist, und die Schulverwaltung sicherzustellen hat, dass deren auch in jeder einzelnen Schule umgesetzt werden. In den Schulen war aber ziemlich schnell klar, dass diese kleinteiligen Vorgaben, die häufig auf einer über Jahrzehnte eingespielten Vorstellung von Unterricht basierten, nicht zu einem erfolgreichen Unterricht führten. Böse Zungen behaupten, dass eine staatliche Bildungseinrichtung damals nur dann einen der renommierten bundesweiten Schulpreise gewinnen konnte, wenn sie bereit war, systematisch gegen die Vorgaben des eigenen Kultusministeriums zu verstoßen. Brauchbare Illegalität schien in staatlichen Schulen die Voraussetzung dafür zu sein, guten Unterricht machen zu können.[1]
Aber die Zeiten haben sich inzwischen grundlegend geändert. Die Kultusministerien haben weitgehend die Vorstellung aufgegeben, zu wissen, wie die einzelne Schule organisiert sein sollte. Sie haben unter dem Stichwort „Schulautonomie“, den Schulen weitgehend Rechte eingeräumt, selbst zu entscheiden, wie sie Lehren und Lernen organisieren wollen. Schulen können in einigen Bundesländern inzwischen weitgehend selbst darüber entscheiden, ob sie weiter gehetzt im 45-minütigen Takt unterrichten, auf 90-minütige Slots umstellen oder gleich ganz auf Projektunterricht umstellen. In Fragen der Notengebung gibt es häufig nur noch abstrakte Vorgaben, die es den Schulen ermöglichen mehrere Jahre weitgehend auf eine Notensetzung zu verzichten. In einigen Bundesländern gehen die Freiheitsräume sogar so weit, dass jahrgangsübergreifender Unterricht möglich ist. Die Handlungsmöglichkeiten in den öffentlichen Schulen, unterscheiden sich nicht mehr grundlegend von privaten Schulen, die immer schon mehr Entscheidungsräume hatten.[2]
Das Problem der Umsetzung auf Schulebene
Wenn man sich heutzutage die Schule seiner Kinder anschaut, dann ähnelt sie auffällig häufig der Schule, die man vor zwanzig Jahren selbst besucht hat. Der Unterricht ist nach wie vor in 45-minütige Blöcke unterteilt, weil die älteren Lehrer ihre Konzepte dafür schon in der Schublade liegen haben. In der Notengebung werden die neugeschaffenen Spielräume häufig nicht ausgenutzt, sondern an dem Schema festgehalten, das man immer schon praktiziert hat und man gar nicht mehr weiß, wie man Schüler ohne Verweis auf schlechte Noten bei der Stange halten kann. Jahrgangsübergreifender Unterricht wird gar nicht erst erprobt, weil man Angst vor den Planungsproblemen hat.
Das Problem ist in der Organisationssoziologie bekannt. Das Paradox besteht darin, dass Organisationen, denen ein höheres Maß an Autonomie zugestanden wird, in ihrer Selbstorganisation jene Strukturen reproduzieren, die allen vertraut sind – und das sind in der Regel die fremd organisierten Strukturen, die bereits vor der Einführung der Selbstorganisation bekannt waren. In Schulen löst man wenig Widerstand bei Lehrern, Eltern und Schülern aus, wenn man trotz aller neuen Autonomieräume genauso weitermacht, wie man es immer schon gemacht hat.[3]
Das Bild ist sicherlich überzogen. Es gibt Schulen, in denen Lehrer nicht nur durch die Dehnung schulinterner Richtlinien guten Unterricht machen, sondern auch versuchen die schulinternen Vorgaben auch gegen den Widerstand von Kollegen zu verändern. Es gibt staatliche Schulen, in denen es der Schulleitung zusammen mit Lehrern, Schülern und Eltern gelungen ist, die Schulen umzubauen, dass alte Schüler ihre Schule kaum noch wiedererkennen würden. Aber in sehr vielen Schulen hat sich trotz der zugestandenen Autonomie sehr wenig getan.
Angesichts dieser nicht genutzten Autonomieräume in Schulen muss man fragen, ob sich die Bildungspolitik nicht stärker trauen sollte, Aussagen darüber zu treffen, welche Rahmenbedingungen am ehesten einen guten Unterricht gewährleisten. Die Erfahrung, dass man durch auf Veränderung ausgerichtete Schulpolitik Wahlen nicht gewinnen, aber sehr wohl verlieren kann, hat unter dem wohlklingenden Label der „Schulautonomie“ zu einer schulpolitischen Zurückhaltung unter Schulpolitikern geführt.
Aber entgegen der Verklärung der Schulautonomie kann gerade der Prozess der Selbstorganisation dazu führen, dass Schulen weiter die alten, eingefahrenen Wege gehen. Das bedeutet nicht, dass man zu einer Schulpolitik zurückkehren muss, in der im Detail vorgegeben wird, wie sich Schulen zu organisieren haben. Aber vielleicht ist es nötig, dass von der Bildungspolitik bei den zentralen Rahmenbedingungen des Unterrichts – der Mindestdauer von Unterrichtsstunden oder des Umgangs der Notengebung – Vorgaben gemacht werden, die die Schulen wenigstens ein bisschen aus dem Trott bringen.
Stefan Kühl ist Professor für Organisationssoziologie an der Universität Bielefeld und arbeitet als Organisationsberater für Unternehmen, Verwaltungen und Ministerien. Zuletzt erschien von ihm „Brauchbare Illegalität. Vom Nutzen des Regelbruchs in Organisationen (Campus 2020).
[1] Der Beitrag geht auf einen Vortrag auf dem Nationalen Bildungsforum am 22.9.2021 in Wittenberg zurück. In den Beitrag sind Ideen und Anregungen aus der Diskussion nach dem Vortrag und aus Pausengesprächen eingeflossen. Eine kürzere Fassung ist erschienen als Stefan Kühl: Guter Unterricht braucht Gelingensbedingungen. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung (25.11.2021), S. 7.; mit einer Replik des Generalsekretärs der Kulturministerkonferenz Udo Michalik: Ein Bildungssystem in Selbstblockade. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung (7.11.2021), S. 7.
[2] Für eine Aufstellung der Freiheitsräume siehe Wissenschaftliche Dienstes Deutscher Bundestag: Dokumentation – Schulautonomie in den Landesgesetzen. Berlin 2020. Torsten Klieme danke ich für den Hinweis auf das Dokument.
[3] Siehe allgemein für den Effekt der Orientierung der Selbstorganisation an den bekannten fremdorganisierten Strukturen Stefan Kühl: Das Regenmacher-Phänomen. Widersprüche im Konzept der lernenden Organisation. Frankfurt a.M., New York 2015, 135ff.

Schreibe einen Kommentar