Autor: Stefan Kühl
-
Die „Erfindung“ von Managementmoden
Die Personen, die bei der Entstehung einer Managementmode einander maßgeblich beeinflussen, können unterschiedliche Hintergründe haben. Einige sind in der Wissenschaft verankert und präsentieren ihre Überlegungen als Ergebnis empirischer, andere entwickeln die Konzepte aus ihrem Beratungsgeschäft heraus und stellen diese als Ergebnis ihres Kontaktes mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Organisationen dar. Wiederum andere präsentieren ihr Organisationskonzept…
-
Was sind Managementmoden
Man kann in Diskussionen über Managementkonzepte alleine schon dadurch Effekte erzielen, dass man die in den letzten Jahrzehnten propagierten Managementmoden aufzählt: „Organische Unternehmensform“, „synthetische Organisation“, „Adhocratie“, „Theory Z“, „Modell J“, „System 5“, „integrativ-innovative Systeme“, „vielzellige Organisation“, „schlankes Unternehmen“, „reengineerte Unternehmung“, „modulare Fabrik“, „fraktale Fabrik“, „responsive Organisation“, „erforderliche Organisation“, „lernende Organisation“, „intelligente Organisation“, „wissensgenerierende Unternehmung“, „kollaboratives…
-

Vom Nutzen von Managementmoden
Managementmoden ziehen zwangsläufig Kritik auf sich. Wirtschaftswissenschaftler bemängeln, dass die Verfechter von Managementmoden mit einem simplen Verständnis von Organisationen arbeiten, das mit der Realität von Organisationen wenig zu tun hat. Sozialwissenschaftler beklagen, dass der Heizwert vieler Managementbücher deren Erkenntniswert bei Weitem übersteigt. Soziologen stellen fest, dass Managementmoden so wenig zu vermeiden sind wie der jährliche…
-
Experimente in Demokratie
Re-Education, angewandte Sozialpsychologie und Gruppendynamik in der frühen Bundesrepublik von Oliver König (Psychosozial-Verlag 2025) Eine Rezension von Stefan Kühl Der US-amerikanische Psychiater Richard M. Brickner beschreibt als typische Merkmale einen ausgeprägten Verfolgungswahn, einen pathologischen Hang zum Größenwahn, ein übertriebenes Machtstreben und eine Tendenz, die eigene Geschichte so zu verfälschen, dass die Anwendung von exzessiver Gewalt…
-
Wie man aus Nationalsozialisten Demokraten gemacht hat –
Die Funktion eines Beschweigens der Vergangenheit Spätestens Mitte der 1950er Jahre musste „niemand mehr befürchten, wegen seiner NS-Vergangenheit von Staat und Justiz behelligt zu werden“. Angeheizt von den „vergangenheitspolitischen Forderungen der rechten Kleinparteien“ hätte, so die Einschätzung des Historikers Norbert Frei, eine „Allparteienkoalition“ des Bundestages, die „nach der Kapitulation aufgezwungene individuelle Rechenschaftslegung“ beendet. Fast alle…
-
Verwaltung – eine (zu) einfache Perspektive
von Stefan Kühl und Philipp Männle Wenn man sich die Organisationshandbücher von Verwaltungen anschaut, dann scheinen diese einem simplen Schema zu folgen. Zu Beginn wird der von der Politik vorgegebene Zweck der jeweiligen Verwaltung dargestellt und das Regelwerk als Hilfsmittel zu deren Erreichung präsentiert. In dem häufig nur noch digital angelegten „Handbuch“ werden die Zuständigkeiten…
-
Die Schwierigkeit, Nationalsozialisten zu Demokraten zu machen
Die Geschichte der frühen Bundesrepublik ist deswegen spannend, weil in der Nachkriegszeit Millionen von überzeugten Nationalsozialisten ihre Einstellungen und ihr Verhalten so änderten, dass sie sich nicht nur mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung arrangierten, sondern nicht selten auch an zentralen Stellen in Politik, Recht, Wissenschaft, Wirtschaft und in den Massenmedien zu ihrer Stabilisierung beitrugen. So wie…
-
Von der Verklärung der Informalität zur Hoffnung auf Formalität
Zur grundlegenden Umstellung einer Führungskonzeption Nach dem Niedergang des NS-Staates war unklar, welche Führungsmodelle in der Bundesrepublik Deutschland als akzeptabel angesehen werden würden. Das klassische autoritäre Führungsmodell hatte an Akzeptanz verloren, aber es war unklar, welches Modell die an die Idee der Gemeinschaft angelehnte Führungskonzeption der Nationalsozialisten ablösen würde. In dieser Situation bot Höhn mit…
-
Die Wiederkehr des Gemeinschaftsgedankens in der Debatte über die Organisationskultur
Nachdem in der frühen Bundesrepublik auf formale Steuerung abzielende Konzepte im Managementdiskurs dominierten, erlebte die informale Steuerung ab den 1970er Jahren im Rahmen der Debatte über Organisationskultur eine Renaissance. Bei der Propagierung der Organisationskultur als Erfolgsfaktor wurden Vorstellungen von Gemeinschaft reaktiviert, die schon in der Idee der Werksgemeinschaft in der Weimarer Republik und später im…
-
Über die überraschende Ähnlichkeit zweier Managementkonzepte
Was Peter F. Druckers „Management by Objectives“ mit Reinhard Höhns „Führung im Mitarbeiterverhältnis“ gemeinsam hat In allen bekannteren – und meist mit Neuigkeitsanspruch vorgetragenen –Managementkonzepten werden Organisationsprinzipien verwendet, die bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts sowohl durch theoretische Ausarbeitungen als auch durch praktische Experimente bekannt sind. Schon vor über hundert Jahren wurde mit strikt hierarchisch…
-
Die autoritäre Führung in Abgrenzung zum kooperativen Führungsmodell
Managementmodelle sind darauf angewiesen, sich als etwas Neues zu präsentieren. Wird ein Managementkonzept lediglich als konsequente Fortsetzung bereits bestehender Konzepte dargestellt, erregt es nicht die nötige Aufmerksamkeit. Neue Modelle sind deswegen gezwungen, sich gegenüber den Konzepten zu positionieren, die vorher in Organisationen propagiert wurden. Integrative organische Organisationsmodelle werden mechanischen, segmentierten Organisationsmodellen gegenübergestellt; innovative, wandlungsfähige Organisationskonzepte…
-
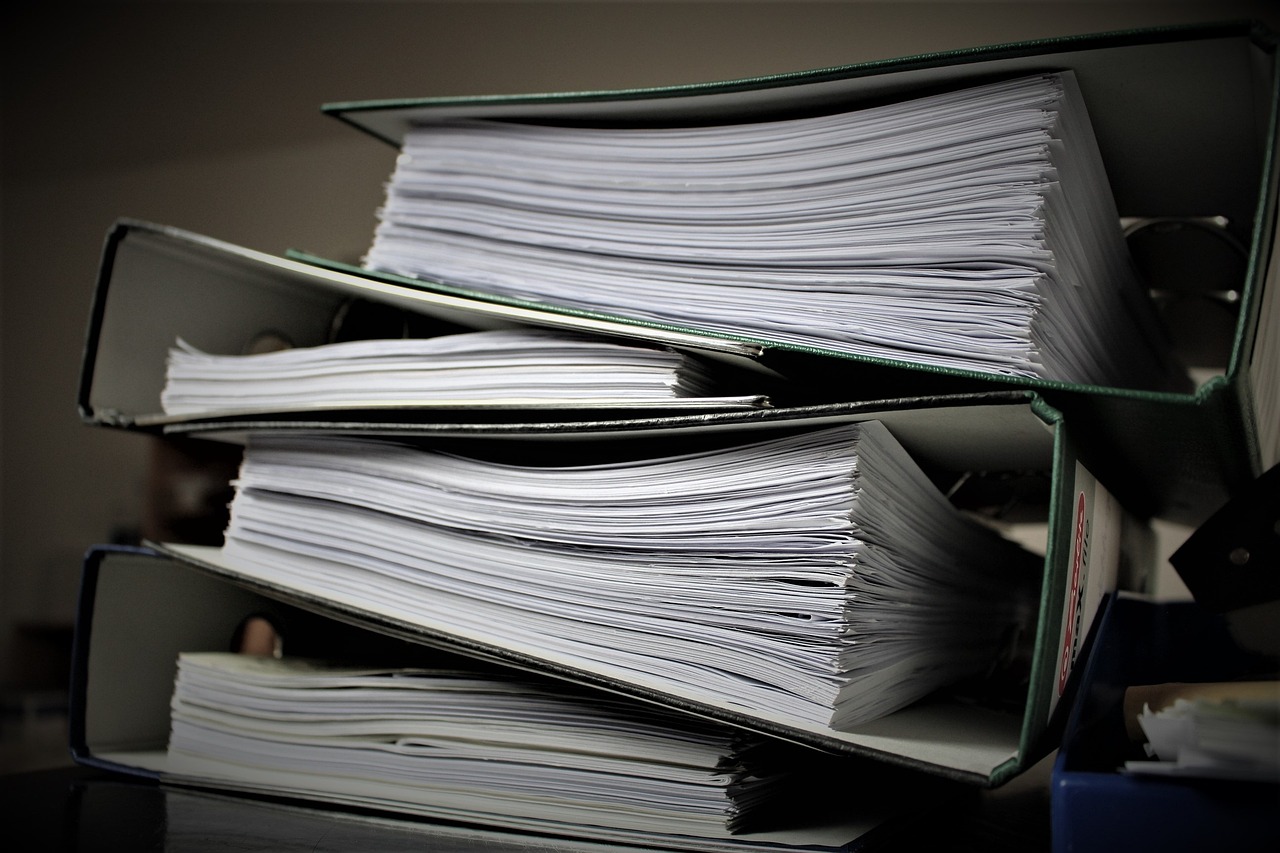
Die Dauerkritik an der Bürokratie lässt das Vertrauen in den Staat erodieren.
Schlank, kooperativ oder handlungsfähig soll der Staat endlich wieder sein: Die Kritik an der Bürokratie ist so alt wie die Bürokratie selbst. Sie hat verheerende Effekte Die Beschwerde über zu viel Bürokratie ist zu einem post-modernen Äquivalent der Klage über schlechtes Wetter geworden.[1] Die Kritik hat sich dabei kaum verändert. Die „Bürokratie“, so die regelmäßig…
