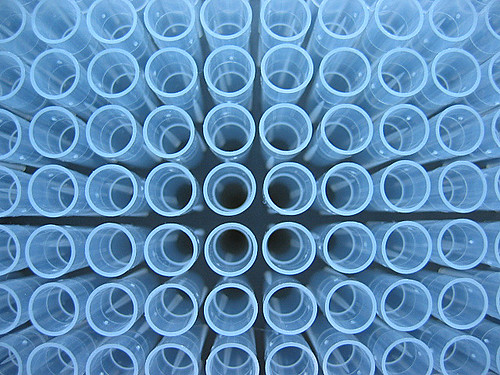
Angesichts der Entwicklungen neuer Kommunikationstechniken rund um das Internet sehen sich die Produktionspraktiken einiger Funktionssysteme vor große Herausforderungen gestellt. Die „Holzmedien“ wissen nicht, wie sie mit den werbefinanzierten Angeboten im Internet umgehen sollen und die Akteure des Gesundheitssystems haben einen virtuellen Horror vor öffentlich einsehbaren Rankings ihrer Dienstleistungen. Auch das Publizieren wissenschaftlicher Forschungsergebnisse verändert sich durch das technisch Machbare. Ein paar Gedanken zum Thema „Wissenschaft 2.0“.
Preprints werden mittlerweile auch bei kleineren Verlagen und außerhalb der Naturwissenschaften angeboten. Wer Erkenntnisse schneller veröffentlichen möchte als es die traditionellen Produktionszyklen von Zeitschriftenausgaben zulassen, kann seine Schnellschüsse direkt auf den Verlagsseiten veröffentlichen, bevor die Erkenntnisse auf dem üblichen Wege ihre papierene Form finden. Die Qualitätssicherung des Peer-Reviews bleibt allerdings erhalten. Nur wird auch das Review-Verfahren dem Druck ausgesetzt, möglichst schnell zu Ergebnissen zu kommen. Gerade in der Naturwissenschaft sind die Zyklen enorm kurz geworden, in denen überhaupt noch etwas Neues publiziert werden kann. Daher müssen Verleger und Zeitschriften mit einer schnellen Begutachtung reagieren. Sonst veröffentlicht der Wissenschaftler halt woanders. Impact-Faktoren einer Zeitschrift – also letztlich die Frage, wie sehr eine Zeitschrift etabliert ist – hängen auch von ihrer technischen Realisierung ab. Ein wissenschaftlich fragwürdiges Qualitätskriterium.
Die Digitalisierung der wissenschaftlichen Zeitschriftenlandschaft bringt nicht nur die zwangsläufige Flut an „Apps“ mit sich. Auch die Diskussionskultur kann sich verändern. Zwar verbirgt nature.com ihre Inhalte weitestgehend hinter den Wänden einer Bezahlstruktur, wodurch wohl weitestgehend verhindert wird, dass nicht-wissenschaftliches Publikum Zutritt erhält. Aber ist man einmal drin, kann man zu Artikeln oder Letters gleich einen Kommentar schreiben. Zwar noch selten, aber wohl zunehmend antworten die Autoren des Artikels direkt auf die Kommentare. So werden Versuchsaufbauten erläutert, weitere Forschungsmöglichkeiten diskutiert und kritische Punkte ausgeleuchtet. Und zwar auf direktem Wege. Man muss nicht warten, bis man den Autor auf einer Konferenz trifft, man muss keinen Grund finden, einen eigenen Artikel zu schreiben (der ja immerhin so gut sein muss, dass er das Begutachtungsverfahren durchläuft). Enthusiasten könnten hier von einer Demokratisierung der Forschungspublikation sprechen. Wer in der Sache eine Anmerkung zu machen hat, kann es tun. Egal, ob Student oder Professor. Hier hat die Bezahlstruktur einen positiven Effekt: Die fachlich Informierten können unter sich bleiben und mehr oder weniger ungestört diskutieren.
Die Sichtbarkeit der Forschungsaktivitäten ist für Universitäten ein zunehmend wichtiger Aspekt ihrer eigenen Vermarktungsstrategie. Daher wundert es nicht, wenn im Kontext des Erscheinens wissenschaftlicher Fachartikel in der Regel sofort (teils) medienwirksame Pressemitteilungen von den Universitäten veröffentlicht werden. Aber auch einige Wissenschaftler bedienen die medienwirksame Platzierung ihrer Forschungsergebnisse. Auch wenn man annehmen muss, dass es sich dabei wohl in erster Linie um stark anwendungsbezogene oder sogar kommerzielle Forschungsprojekte handeln wird, kann man fragen, ob es einen zunehmenden trial by twitter der Wissenschaft geben wird und damit eine ganz neue Form des Peer-Review entsteht. Gerade in den USA ist zu beobachten, dass Wissenschaftler Blogs und/oder Twitter nutzen, um ihre Forschung öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. Teils mag daraus sogar ein wissenschaftlich anspruchsvoller Dialog entstehen. Ein neues Peer-Review-Verfahren wird sich aber nicht dadurch ergeben, dass sich wissenschaftliche Erkenntnisse in Zukunft vor der Masse des Laienpublikums und der öffentlichen Meinung wird beweisen müssen. Die Anforderungen an öffentlichkeitswirksamer Darstellung der Forschungsergebnisse wird zukünftig sicherlich steigen (wenngleich das sehr stark auf die konkreten Disziplinen ankommt), weil die Finanzierung der Forschung mitunter auch von ihrer (potentiellen) Sichtbarkeit abhängt. Aber die fachliche Begutachtung der Forschungsergebnisse kann funktional nicht durch eine plebiszitäre Abstimmung ersetzt werden. Die Fiktion von Demokratie, die im „Mitmachweb“ immer wieder propagiert wird, scheiterte schon an viel leichteren Übungen. Häufig verstand nicht einmal die Scientific Community ein neues Forschungsvorhaben, das sich im Verlauf der Zeit allerdings als bahnbrechend herausstellt. Wie sollte dann die öffentliche Meinung darüber entscheiden können?
Mir scheint, dass die Wissenschaft zwar lernen muss „auf der Klaviatur der öffentlichen Meinung zu spielen“ und für ihre Diskussionen auch neue Technologien heranziehen kann. Aber eine Öffnung im Sinne des freien Zugangs zu Inhalten scheint im Falle der Wissenschaft nicht sinnvoll zu sein. Ganz zu schweigen von einer breiten Beteiligung der Öffentlichkeit an einer inhaltlichen Diskussion über Wahrheit.
Foto: estherase

Schreibe einen Kommentar