Autor: Stefan Kühl
-
Digitalisierung als politischer Staubsaugerbegriff
Weswegen die Diskussion über die Einrichtung eines Digitalisierungsministeriums an der eigentlichen Sache vorbeigeht Die Idee der Einrichtung eines eigenen Digitalisierungsministeriums geistert seit über einem Jahrzehnt durch die Öffentlichkeit. Immer wieder wird gefordert, dass ein so wichtiges Thema wie die Digitalisierung nicht in verschiedenen Ressorts aufgesplittert werden darf, sondern in einem eigenen Digitalisierungsministerium zusammengezogen werden sollte.…
-
Die Ähnlichkeit nationalsozialistischer Führungskonzepte mit aktuellen Führungsmodellen
Ich fürchte nicht die Wiederkehr des Faschismus gegen die Demokratie, sondern die Wiederkehr des Faschismus als Demokratie Rephrasierung eines Gedankens von Theodor W. Adorno Beim Blick auf neue Managementkonzepte mit ihrer Verklärung der Gemeinschaft, der Ausrichtung auf einen übergeordneten Zweck der Arbeit und der Forderung nach einer charismatischen, transformativen Führung mögen „manche Aspekte des Nationalsozialismus“…
-
Donald Trump und Elon Musk haben der Bürokratie den Krieg erklärt. Taugt ihr rabiates Vorgehen?
Langfassung eines Interviews in der FAZ vom 14.2.2025 – hier mit einigen Zuspitzungen, Pointierungen und mit einigen Fußnoten mit Literaturhinweisen. Herr Kühl, Elon Musk und Donald Trump haben im großen Stil den Abbau von Bürokratie angekündigt. Und sie nehmen dafür die Kettensäge zur Hand. Werden sie damit Erfolg haben? Da ist viel Symbolik dabei. Wenn Abbau…
-
Ministerien
Ein Hort der Stabilität und der Stagnation Nach der Bundestagswahl wird sich wahrscheinlich das politische Programme der Regierung an zentralen Punkten ändern. Aber eine Sache wird gleichbleiben – die Art, in der in den einzelnen Ministerien gearbeitet wird und die Form, in der die Ministerien miteinander kooperieren. Die Aufteilung der Arbeit in einem Ministerium auf…
-
Wie motivieren Verwaltungen?
Die Möglichkeiten zur Motivation von Verwaltungsmitgliedern Stefan Kühl und Philipp Männle Verwaltungen konkurrieren mit Unternehmen, Verbänden, Universitäten, Schulen oder Gerichten um Arbeitskräfte. Je knapper das Arbeitskräfteangebot, je größer die Konkurrenz um Mitarbeiter, desto stärker sind Verwaltungen darauf angewiesen, eigene Anreize für eine „Teilnahmemotivation“ am öffentlichen Dienst zu entfalten (vgl. Luhmann 1964, S. 104). Sie können…
-

Die Doppelstandards beim zivilen Ungehorsam
Über das auffällige Erregungspotential von Politikern im Angesicht der Klimaproteste Anfang 1984 kam es in Deutschland zu Straßenblockaden, die alle Aktionen der heutigen Klimaaktivisten bei weitem in den Schatten stellen. LKW-Fahrer blockierten über Tage die Inntal-Autobahn, um gegen die langsame Abfertigung durch Zollbeamte zu protestieren.[1] Angesichts der heftigen Reaktionen auf die Straßenblockaden der Klimaaktivisten der…
-
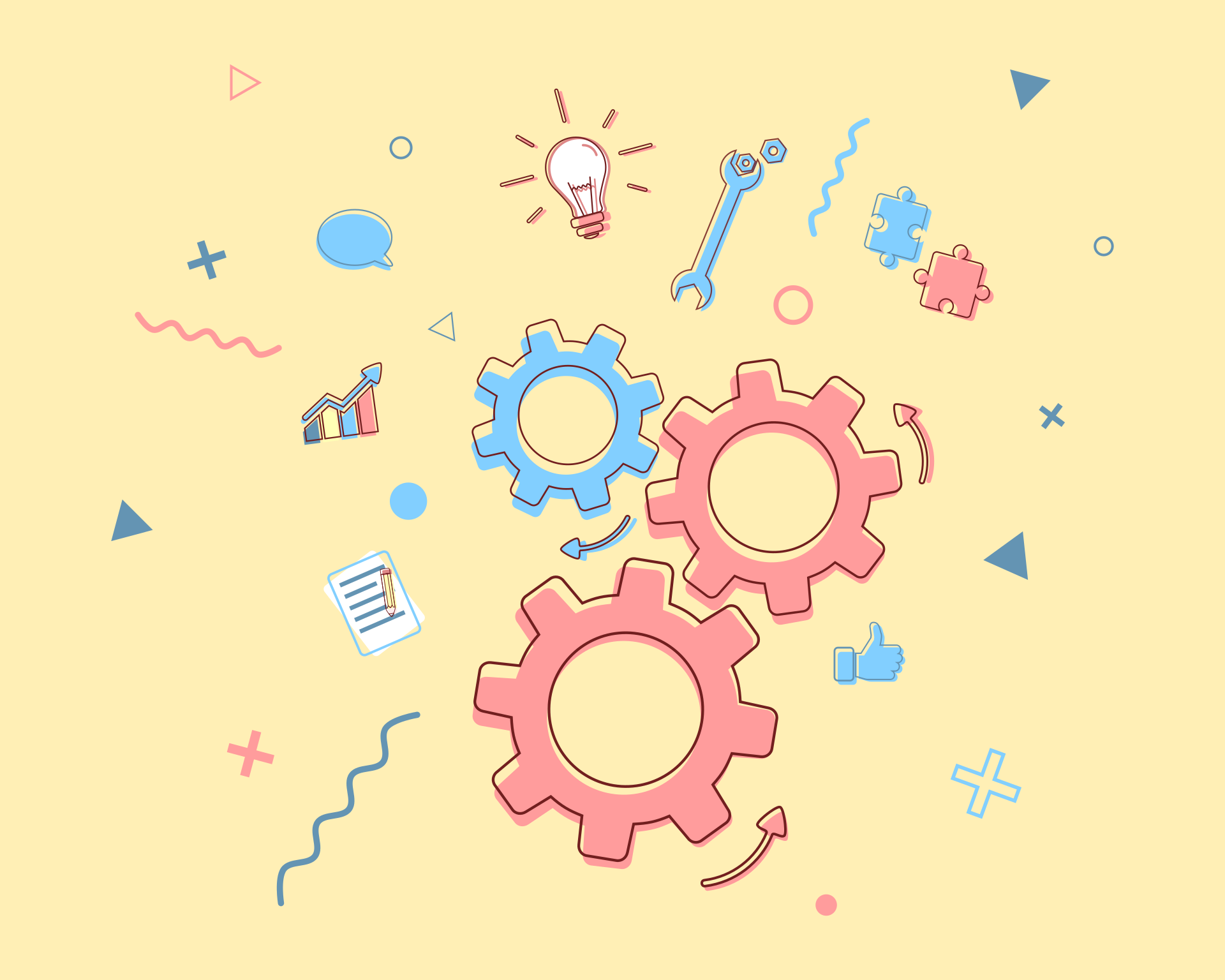
Systemtheoretische Perspektiven auf Organisationen
Luhmanns bekannte und unbekannte Schriften zur Organisation Um seine Theorietechnik deutlich zu machen, hat Niklas Luhmann sehr stark auf Metaphern des Bauens zurückgegriffen. Es wimmelte in seinen Artikeln, darauf hat zuletzt Ernst Lukas aufmerksam gemacht, nur so von Vokabeln, wie „Aufbau“, „Einbau“, „Unterbau“ oder „Umbau“. Sie kämen in immer neuen Kombinationen vor – etwa „Systemaufbau“,…
-

Softwarebasierte Kontaktentmutigung
Warum an Hochschulen häufig nur über Noten kommuniziert wird Aus den Hochschulen wird berichtet, dass Studenten zwar nicht selten bis zu ihrem Abschluss mehr als fünfzehn Noten bekommen, ihnen aber kein einziges Mal mitgeteilt wird, auf welcher Einschätzung die Notengebung basiert. Studenten sind überrascht, wenn ihnen im Gutachten zur Bachelorarbeit erklärt wird, dass man für…
-
Zu den Veränderungsblockaden in Schulen
Fast alle haben eine Meinung dazu, wie man Schulen besser machen kann. Schulen sind der einzige Organisationstyp, in dem noch eine Zwangsmitgliedschaft besteht und deswegen hat jeder – je nach eigener Schulkarriere – 9000 bis 15000 Stunden Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, wie Schulen funktionieren, wie man da am besten durchkommt und wie man…
-
Das Scheitern der Moralphilosophie an der Organisationsfrage
Rezension zu Lisa Herzog (2021): Das System zurückerobern. Moralische Verantwortung, Arbeitsteilung und die Rolle von Organisationen in der Gesellschaft. Darmstadt: wbg academics Moral spielt in den Diskursen von Organisationen eine immer wichtigere Rolle. Ministerien bekennen sich in ihren Selbstdarstellungen zur Nachhaltigkeit. Verwaltungen propagieren Diversität als einen zentralen Wert ihrer Personalpolitik. Unternehmen propagieren – ganz im…
-
Auskühlung – Über das Management von Erwartungen in Organisationen
Die Aussicht auf Aufstieg ist ein zentrales Motiv dafür, dass sich Personen über das formal erwartete engagieren. Die Möglichkeit auf eine studentische Hilfskraftstelle kann Studierende dazu motivieren, sich bei einzelnen Lehrenden besonders ins Zeug zu legen. Die Hoffnung auf eine Karriere in einem Unternehmen können Mitarbeiter dazu verleiten, Aufgaben zu übernehmen, die in der Stellenbeschreibung…
-
Zum Verlust der Zufälligkeit
Die Bedeutung von Zwischenräumen an Hochschulen Die Pandemie hat Lehrende an den Hochschulen dazu gezwungen, innerhalb von kurzer Zeit auf digitale Lehre umzustellen. Die Lernkurve ist dabei in den meisten Fällen steil gewesen. Lehrende haben schnell verstanden, dass es für den Erfolg eines Seminars zentral ist, dass alle Studierenden ihre Videokamera anhaben, weil sonst eine…
